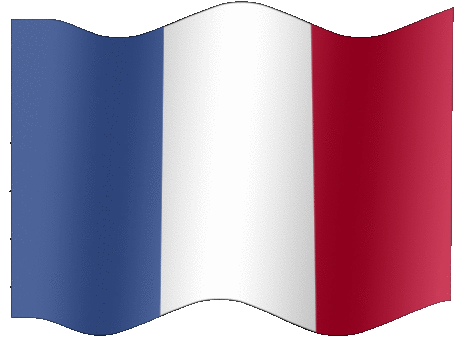1. Der Auftraggeber kann keine Gewährleistungsansprüche geltend machen, wenn er den behaupteten Mangel nicht ordnungsgemäß anzeigt. Der Mangel muss zumindest hinsichtlich seines äußeren objektiven Erscheinungsbildes so genau beschrieben werden, dass der Auftragnehmer zweifelsfrei ersehen kann, was im Einzelnen beanstandet wird bzw. welche Abhilfe von ihm verlangt wird.
2. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt im VOB/B-Vertrag eine fristgebundene Aufforderung zur Mangelbeseitigung voraus.
3. Eine individualvertraglich vereinbarte Verjährungsfrist für Mängelansprüche gilt nicht für den Fall des arglistigen Verschweigens von Mängeln.
4. Dem umfassend mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten oder Ingenieur obliegt im Rahmen seiner Betreuungsaufgaben nicht nur die Wahrung der Auftraggeberrechte gegenüber dem Bauunternehmer, sondern auch und zunächst die objektive Klärung von Mangelursachen, selbst wenn zu diesen eigene Planungs- oder Aufsichtsfehler gehören.
5. Die dem Architekten bzw. Ingenieur vom Bauherrn eingeräumte Vertrauensstellung gebietet es, diesem im Laufe der Mängelursachenprüfung auch Mängel des eigenen Werks zu offenbaren, so dass der Bauherr seine Auftraggeberrechte auch gegen den Bauüberwacher rechtzeitig vor Eintritt der Verjährung wahrnehmen kann.
6. Ist die sog. Sekundärhaftung begründet, so führt sie dazu, dass sich der Architekt bzw. der Ingenieur nicht auf die Einrede der Verjährung des gegen ihn gerichteten Gewährleistungsanspruchs berufen darf.
OLG Naumburg, Urteil vom 25.06.2022 – 2 U 63/18
Gründe
A.
Die Klägerin macht gegen die Beklagten Gewährleistungsansprüche geltend, und zwar gegen die Beklagte zu 1) aus einem Vertrag über die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (künftig: BHKW, Komplex I A) und gegen die Beklagte zu 2) aus einem Vertrag über Ingenieurleistungen (künftig: Komplex I B). Die Klägerin und die Beklagte zu 1) streiten darüber hinaus über restlichen bzw. überzahlten Werklohn aus einem zugehörigen Wartungs- und Instandhaltungsvertrag (künftig: Komplex II).
Komplex I:
Die Klägerin beauftragte die Beklagte zu 2) mit schriftlichem Ingenieurvertrag vom 12.12.1996 (Anlage K 1, GA Bd. I Bl. 19 ff.) mit der Planung und Bauüberwachung der Errichtung eines BHKW in W. gemäß den Grundleistungen aus dem Leistungsbild der Technischen Ausrüstung (§ 73 HOAI 1995) einschließlich der Leistungsphasen 8 (Objektüberwachung / Bauüberwachung) und 9 (Objektbetreuung und Dokumentation). Nach § 11 des Ingenieurvertrages vom 12.12.1996 richtete sich die Haftung nach den gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts. In Absatz 5 vereinbarten die Vertragsparteien eine Verjährungsfrist von fünf Jahren. Die Verjährung sollte beginnen mit der Erfüllung der letzten nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung, spätestens jedoch „bei Übernahme der baulichen Anlage“. Für Leistungen, welche nach der Übergabe noch zu erbringen waren, sollte die Verjährung erst mit der Erfüllung der letzten Leistung beginnen. In Absatz 6 war abweichend geregelt, dass Schadensersatzansprüche wegen positiver Vertragsverletzung nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren sollten.
Die Beklagte zu 2) schloss mit ihrer nunmehrigen Streithelferin am 04./07.03.1997 einen Ingenieurvertrag (Anlage B02-01, GA Bd. VII Bl. 72 ff.); danach übernahm die Streithelferin Leistungsanteile der Beklagten zu 2) gegenüber der Klägerin, u.a. die Bauüberwachung zu 80 % und die Objektbetreuung zu 100 %. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb (vgl. Bekanntmachung Anlage K 56, KA I Bl. 3) beauftragte die Klägerin die Beklagte zu 1), bis zum 31.12.2003 noch firmierend unter R. GmbH, mit Zuschlagsschreiben vom 07.05.1997 (vgl. GA Bd. I Bl. 24) auf das Angebot vom 10.04.1997 (GA Bd. I Bl. 30 ff.) und entsprechend den Festlegungen des Vergabegespräches am 07.05.1997 (GA Bd. I Bl. 25 ff.) mit dem Neubau eines Blockheizkraftwerkes mit etwa 6,5 MW elektrischer Leistung und etwa 8 MW thermischer Leistung. Das Leistungsverzeichnis in den Vergabeunterlagen enthielt im Wesentlichen eine funktionale Leistungsbeschreibung, d.h. es gab vor allem die modulare Struktur des BHKW vor und bestimmte die zu erreichenden Leistungsparameter. Bestandteil des Bauauftrags war eine Erklärung der Beklagten zu 1), wonach sie sich zur Lieferung und Montage von fünf Generatoren des Herstellers M., eines Tochterunternehmens der D. AG, vom Typ (…) verpflichtete. Die Beklagte zu 1) bestätigte die Auftragserteilung mit ihrem Schreiben vom 21.05.1997.
Nach dem Inhalt der Leistungsbeschreibung war das BHKW in drei Teilbereiche gegliedert: Im Teilbereich Energieumwandlung sollten unter einer Schalldämmhaube fünf Gasmotoren (mit Erdgas betriebene Generatoren, künftig: Motor) Strom erzeugen, welcher über einen Blocktransformator in das Mittelspannungsnetz eingespeist werden sollte. Unter der Schalldämmhaube sollten je Modul ein Luftkühler (sog. Tischkühler unter Verwendung von Außenluft) und ein Abgasturbolader zur Ableitung des Rauchgases verwendet werden. Im zweiten Teilbereich, der Abgasstrecke, war je Modul eine Heißluftstrecke mit je einem Primärschalldämpfer und einem Sekundärschalldämpfer sowie ein Abgaswärmetauscher vorgesehen; an letzterem sollte Heizwasser für die Fernwärmeversorgung erhitzt werden. Das dadurch gekühlte Abgas sollte aus allen fünf Modulen gemeinsam in den dritten Teilbereich, die Schornsteinanlage (sog. Kamin) geleitet werden.
Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und mithin des Vertrages waren sog. Zusätzlichen Vertragsbedingungen (künftig: ZVB, vgl. GA Bd. I Bl. 45 ff.). Nach deren § 5 wurde „hinsichtlich der Lieferung, Montage, Aufmaß und Abrechnung“ festgelegt, dass nachfolgende Vertragsbestandteile in der angegebenen Reihenfolge Gültigkeit erlangen sollten, u.a. in Ziffer 3 die ZVB, in Ziffer 4 die Erklärungen des Bieters, in Ziffer 5 die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers sowie in Ziffer 7 die VOB. In § 14 Abs. 1 ZVB wurde zwingend eine förmliche Abnahme der Leistungen vereinbart, welche vom Auftragnehmer zu beantragen sei. Sodann hieß es „VOB/B § 12 wird ausdrücklich ausgeschlossen.“ Die Abnahme werde durch eine frühere Benutzung, Inbetriebnahme oder die Schlusszeichnung nicht ersetzt. Es sei ein gemeinsames Abnahmeprotokoll zu fertigen und von beiden Vertragsseiten zu unterzeichnen. Mit der erfolgten Abnahme beginne die Gewährleistung. In § 15 ZVB waren Regelungen zum Nachweis der zugesicherten Leistungsmerkmale (Abs. 1) und zu einer vorrangigen Nachbesserung (Abs. 2) enthalten. Ein Schadensersatzanspruch sollte nur für den Fall begründet werden, dass auch die zweite Nachbesserung eines „Schadens“ keinen Erfolg erbringe (Abs. 3 Satz 1). Sodann hieß es, dass die Gewährleistungsfrist für nachgebesserte Anlagenteile erst mit deren Abnahme beginne (Abs. 3 Satz 2). § 17 ZVB sah eine Gewährleistungsfrist von 36 Monaten ab Abnahme vor. Insoweit enthielt Ziffer 8 des Protokolls des Vergabegespräches vom 07.05.1997 die Einschränkung, dass diese Frist nur unter der Bedingung gelte, dass zwischen den Parteien ein Wartungsvertrag für die Dauer der Gewährleistung geschlossen werde.
Im Protokoll des Vergabegesprächs vom 07.05.1997, dort unter Ziffer 4, wurde vereinbart, dass die von der Auftraggeberin in der Ausschreibung vorgegebenen Vertragsbedingungen Gültigkeit entfalteten, ungeachtet etwaiger in den Angebotsunterlagen der Auftragnehmerin enthaltener Abweichungen, soweit nachfolgend nichts Anderes vereinbart sei. In Ziffer 7 erklärte die Klägerin, dass die Motorenherstellerin bestätige, dass für Zündkerzen derzeit lediglich eine Standzeit von 1.500 Betriebsstunden garantiert werden könne, auch wenn der Erwartungswert für die Lebensdauer 3.000 Betriebsstunden betrage.
Die Beklagte zu 1) führte die beauftragten Bauleistungen im Jahr 1997 durch; die Streithelferin der Beklagten zu 2) überwachte in deren Auftrag die Ausführung der Bauarbeiten.
Am 23.12.1997 unterzeichneten die drei Prozessparteien ein so bezeichnetes „Übergabeprotokoll zum Gefahrenübergang während des Probebetriebes …“ (vgl. GA Bd. II Bl. 32 f.); danach erfolgte der Gefahrenübergang von der Beklagten zu 1) an die Klägerin bereits während des Probebetriebes von einer Woche. Nach Bestätigungen über Funktionsprüfungen, Einweisungen des Bedienpersonals, Betriebsbereitschaft der Sicherheitseinrichtungen und über die Übergabe von Dokumentationen zur Anlage hieß es:
„Die Gewährleistung beginnt für die BHKW-Anlagen am 23.12.1997.“
Das Protokoll schloss mit der – durch Fettdruck grafisch hervorgehobenen – Ankündigung, dass die Abnahme der Anlage für den 30.12.1997 vorgesehen sei.
Die förmliche Abnahme der Werkleistungen der Beklagten zu 1) erfolgte am 30.12.1997. In dem „Übergabeprotokoll zur förmlichen Abnahme …„, welches von Vertretern der Klägerin, der Beklagten zu 1) und der Streithelferin der Beklagten zu 2) unterzeichnet wurde (vgl. Anlage B 1, GA Bd. II Bl. 29), wurde niedergelegt, dass förmliche Übergabe gemäß § 14 ZVB erfolge, eine beiliegende Restpunkteliste Bestandteil des Protokolls sei und sich die Klägerin verpflichte, die dort aufgeführten Maßnahmen abzuarbeiten. Wegen der zu erwartenden umfang reichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der geforderten Schallwerte wurde eine gestaffelte Vergütungszahlung vereinbart. Im Hinblick auf fehlende Leistungsnachweise wurde eine Nachholung binnen vier Wochen vereinbart. Die Abnahme umfasste alle fünf Module, obwohl nur vier Module den Probebetrieb erfolgreich abschlossen; das Modul 2 wurde trotz der bis zum 29.12.1997 nicht behobenen Störung ebenfalls abgenommen.
Die Restpunkteliste zum Übergabeprotokoll (GA Bd. II Bl. 30) enthielt unter der Bemerkung: „Die folgenden Punkte können witterungsbedingt erst ab März 1998 abschließend geprüft werden“ u.a. den Eintrag: „Funktion Gemischkühlung“ (Ziffer 4.2) und umfasste als „Sonstige Rest punkte“ u.a. die Beseitigung zu hoher Schallemissionen gemäß noch ausstehender Messungen – Termin nach Messung (Ziffer 5.1) und die Herstellung einer automatischen Wiederzuschaltung der Module nach kurzzeitiger Stromnetzstörung – schnellstmöglich (Ziffer 5.3).
In den Jahren 1998 bis 2000 führte die Klägerin diverse Arbeiten zur Nachbesserung bzw. Mangelbeseitigung aus.
Komplex II:
Am 20.05.1998 schlossen die Klägerin und die Beklagte zu 1) einen schriftlichen Wartungsvertrag (Anlage K 19, GA Bd. I Bl. 154 ff.). Dieser Vertrag wurde mit „Wartungs- und Instand haltungsvertrag der BHKW-Anlage (Module und periphere Anlagen)“ überschrieben. In der Präambel (Ziffer 1 Abs. 1) wurden die Ziele des Vertrages damit umrissen, dass es um die Instandhaltung während der Gewährleistungsdauer, um die Absicherung der Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers, um die Regelwartung und Instandhaltung nach der Gewährleistung zum Erhalt der zu erwartenden Lebensdauern sowie um die Gewährleistung des sicheren Anlagenbetriebes und die Erhaltung der zugesicherten Eigenschaft „Verfügbarkeit“ gehe. Als Leistungen der Auftragnehmerin definierte Ziffer 2 in seinem Absatz 1 die Leistungen während der Gewährleistungszeit (drei Jahre, mindestens 15.000 Betriebsstunden, künftig: Bh) als „die Regelwartungsleistungen sowie sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsleistungen (auch in Bezug auf Verschleißteile) …, die zur Aufrechterhaltung eines regulären Anlagenbetriebes erforderlich sind …“. Eine gleichlautende Regelung enthielt Absatz 2 für die Zeit nach Ablauf der Gewährleistungszeit bis zu 48.000 Bh. Die Höhe des Entgelts wurde in Ziffer 4 für die Module jeweils in Abhängigkeit von Bh und für periphere Anlagen pro Kalenderjahr jeweils pauschal vereinbart und enthielt jeweils sämtliche Kosten der Auftragnehmerin für Lohn, Material, Reisekosten, Auslösungen u.s.w. In dem Vertragsformular wurden sieben einzelne „Instandhaltungsarbeiten“ aufgeführt, darunter u.a. der Zündkerzenaustausch, der Gas filter- und der Luftfiltereinsatzwechsel; in diesen Positionen war das vorgesehene Feld für Einzelpreise jeweils nicht ausgefüllt. Der Vertrag sollte ohne besondere Kündigung mit dem Ab lauf der 65.000. Betriebsstunde enden. Die Parteien streiten darüber, ob von der Beklagten zu 1) gefertigte Anlagen zum Wartungsvertrag (vgl. in Anlage B 14, GA Bd. II Bl. 96 ff.) Vertragsbestandteil wurden. In diesen Anlagen stellte die Beklagte zu 1) den Umfang der Inspektionsarbeiten in sieben sog. Erhaltungsstufen dar, darunter neben Prüfungs-, Reinigungs- und Nachstellarbeiten auch den Tausch von Zündkerzen und Zündkabeln, von Kurbelraumentlüftungsventilen, Luftfiltereinsätzen, Pick-up-Elektronikreglern, Zylinderköpfen, Rohrverbindern und Kühlwasserschläuchen, Anlasserteilen, Kolbenringen, Pleullagern, Kühlwasserpumpen, der Ölpumpe und von Schwingungsdämpfern. Handschriftlich war hinzugesetzt: „Oxi.-Kat … tauschen nach / bei E5, E6, E7 enthalten!“. Diese Ersatzteile wurden tabellarisch mit Teile und Gruppennummer aufgeführt. Die Parteien streiten weiter darüber, ob der maschinenschriftliche Klammer-Zusatz „Unterschriften gelten nur in Verbindung mit Schrb. vom 29.06.98“ unter den Unterschriften zum Vertrag bereits bei Vertragsunterzeichnung vorhanden war. Mit ihrem Schriftsatz vom 06.04.2005 (Anlage K 61, vollständig in KA 1, Bl. 5) schlug die Klägerin zur Regelung der Erbringung der laufenden Wartungsleistungen vor, dass die Beklagte zu 1) auf ein etwa bestehendes Zurückbehaltungsrecht im Hinblick auf ausstehende Forderungen verzichte (Ziffer 1) und die Klägerin zusichere, die Kosten für die Generalüberholung und für die durchzuführenden Arbeiten aus dem Wartungsvertrag zu zahlen (Ziffer 2). Sodann hieß es:
(Die Klägerin) „… verzichtet auf die Aufrechnung mit Forderungen, die Gegenstand des beim Landgericht Halle unter dem Aktenzeichen 9 O 538/03 anhängigen Rechtsstreits sind. Dieses Aufrechnungsverbot endet, sobald eine Zwangsvollstreckung wegen der Forderungen unserer Mandantin möglich ist.“
Für alle Leistungen der Beklagten zu 1), welche nach der Auffassung der Klägerin von der Pauschalvergütung im Wartungsvertrag erfasst und nach der Auffassung der Beklagten zu 1) gesondert vergütungspflichtig seien, werde bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens die Ausführung der Arbeiten und die Zahlung der Vergütung verabredet, wobei sämtliche Zahlungen auch ohne gesonderte Erklärung jeweils unter dem Vorbehalt der Rückforderungen stünden (Ziffer 3). Diesem Vorschlag stimmte die Beklagte zu 1) zu.
Ab dem Beginn des Jahres 2009 erbrachte die Beklagte wegen des Streits um die Vergütung keine Wartungsleistungen mehr. Sie kündigte den Wartungsvertrag mit Schreiben vom 14.09.2009 (Anlage K 70). Die Klägerin widersprach der Kündigung, nahm aber keine Wartungsleistungen der Beklagten zu 1) in Anspruch. Beweisverfahren Am 29.12.2000 reichte die Klägerin beim Landgericht Halle einen Antrag auf Durchführung eines Beweisverfahrens ein, welcher den hiesigen Beklagten zu 1) und zu 2) jeweils am 08.01.2001 zugestellt wurde. Gegenstand der Beweisaufnahme waren Korrosionserscheinungen an den Abgaswärmetauschern und der Abgasanlage (Rauchrohre) der Module 1 bis 5, die Dichtheit des Primärschalldämpfers am Modul 2 und die Überschreitung des vom Motorenhersteller vorgegebenen Grenzwerts für den Abgasgegendruck. Diesen Antrag nahm die hiesige Klägerin mit einem am 16.10.2002 beim Landgericht eingegangenen Schriftsatz zurück.
Schiedsgutachter-Verfahren:
Die drei Prozessparteien schlossen am 06./28./30.08.2002 einen Schiedsgutachtervertrag (K 40, GA Bd. III Bl.165 ff.). Sie vereinbarten, dass sie die B. (B. ) mit der Erstellung eines Schiedsgutachtens darüber beauftragen, ob die Abgaswärmeaustauscher der Module 1 bis 5 von der Rauchgas- oder der Heizwasserseite her korrodiert seien, ob bei unveränderten Betriebsbedingungen auch künftig mit Korrosion von einer der beiden Seiten ausgehend zu rechnen sei, ob auch die Abgasanlage (Rauchrohre von den Abgaswärmetauschern bis zum Kamin) korrodiert sei, ob und ggf. weswegen vier von fünf Abgaswärmetauschern defekt seien, sowie, ob der Abgasgegendruck höher als vom Motorenhersteller vorgegeben sei und ob dieser Wert ein Richt- oder ein Grenzwert sei. Der Schiedsgutachter sollte weiter die Ursache etwaiger Mängel feststellen (fehlerhafte Werkstoff o. Katalysatorenauswahl, Umweltbedingungen, wie Qualität des Heizwassers, des Erdgases, der Ansaugluft o. des Schmieröls, Belastung der Schalldämmkulissen mit schwefelhaltigen Substanzen, Einfluss v. An- und Abfahrhäufigkeiten). Gegenstand des Auftrags waren zudem acht mögliche Mangelerscheinungen an der Schornsteinanlage. In Ziffer II wurde klargestellt, dass der Schiedsgutachter allein technische Fragen klären und keine rechtliche Bewertung vornehmen solle. In Ziffer III vereinbarten die Parteien, dass die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, welche sich auf Mängel beziehen, die Gegenstand dieser Vereinbarung seien, beginnend mit dem Abschluss dieser Vereinbarung und endend drei Monate nach Beendigung des Schiedsgutachterverfahrens gehemmt sei. In Ziffer V legten die Parteien zur Beendigung des Schiedsgutachterverfahrens fest, dass die Parteien nach der Vorlage des schriftlichen Gutachtens binnen drei Monaten Ergänzungsfragen stellen bzw. eine Ladung des Gutachters zur Anhörung beantragen könnten (Absatz 1), dass sie binnen einer Woche nach der Vorlage des schriftlichen Ergänzungsgutachtens der Beendigung des Verfahrens begründet widersprechen könnten (Absatz 2) und dass im Falle des Widerspruchs einer Partei das Verfahren endet mit der Vorlage eines weiteren Ergänzungsgutachtens oder mit der Erklärung des Schiedsgutachters, dass alle Beweisfragen beantwortet seien (Absatz 3). Unter Ziffer VIII vereinbarten die Parteien, dass die Entscheidung des Schiedsgutachtens endgültig und verbindlich sei, sowie, dass eine Überprüfung nur stattfinde, wenn das Schiedsgutachten grob unbillig sei und deswegen i.S.d. §§ 412, 493 ZPO unbrauchbar und aus diesem Grunde für die Parteien nicht verbindlich sei.
In ihrem Schiedsgutachten unter dem Geschäftszeichen VII.3/13883 (undatiert, Anlage K 41, GA Bd. III Bl. 169 ff.; lt. Klägerin vom 19.12.2003, vgl. GA Bd. IX Bl. 33) kam die B. durch Dipl.-Ing. Z. und Dr. rer. nat. E. zu der Einschätzung, dass die Schäden an den Abgaswärmeaustauschern durch Kondensatwasser aus dem Abgas verursacht worden seien; Gleiches träfe auf weitere Schäden an der gesamten Abgasanlage zu. Beschrieben wurden korrosive Angriffe in Form von Lochkorrosion, ausgehend von der Abgasseite, und deutliche Rissbildungen im Bereich der Schweißnähte. Die Ausführung der Schweißnähte ließe keine Fehler erkennen. Die Schiedsgutachter diskutierten zwei mögliche Schadensursachen: Die durch den nicht bestimmungsgemäßen Rückfluss von sauren Kondensaten aus dem Abgas in die heißen Bereiche des Wärmeübertragers ausgelöste Korrosion (insoweit müsse dafür Sorge getragen werden, dass das Kondensat an der Stelle seiner Entstehung aus der Abgasanlage entfernt werde) und eine Rissbildung als Folge des durch Ablagerungen verschlechterten Wärmeübergangs zwischen Abgas und Rohrwandung (d.h. thermische Überlastung). Auf Ergänzungsfragen der Klägerin (Aufstellung auf GA Bd. IX Bl. 33 f.) antwortete das B. mehrfach, zuletzt mit der ergänzenden Stellungnahme vom 30.06.2004 (Anlage B 23, GA Bd. III Bl. 196 ff.). Darin bestätigte der Schiedsgutachter E., dass eine nennenswerte Kondensatmenge nur außerhalb des geschädigten Bauteils, des Abgaswärmetauschers, entstehen könne; über die Ursache könne jedoch ohne Kenntnis der jeweiligen Betriebs-zustände der Anlage nur spekuliert werden. Als Ursachen kämen Mängel in der Planung, in der Ausführung, in der Wartung oder in der Art der Betriebsführung des Kraftwerks in Betracht; dies könne allein technisch nicht beurteilt werden. Die Klägerin beanstandete am 09.07.2004, dass die Leistungen des Sachverständigen nicht ordnungsgemäß seien; weitere Fragen stellte sie nicht.
Vorfall 1:
Am 11.12.2002 fiel während einer planmäßigen Wartung (Probebetrieb zur Inspektion) zu nächst das Modul 2 wegen eines Sicherungsabfalles im Schrank der Motorensteuerung aus. Ein Monteur der – als Nachauftragnehmerin der Beklagten zu 1) im Rahmen des Wartungsvertragsverhältnisses tätigen – D. AG schaltete die Motorensteuerung wieder zu. Im zeitlichen Zusammenhang damit wurde ein Ausfall der übergeordneten SPS-Steuerung aus gelöst und damit ein Ausfall der weiteren vier Module verursacht.
Die Haftpflichtversicherung der Beklagten zu 1) teilte nach Einholung eines Gutachtens mit, dass sie hierin keinen Versicherungsfall sehe.
Vorfall 2:
Am 20.01.2003 fiel das Modul 2 aus, weil sich in dem zugehörigen Sekundärschalldämpfer Teile gelöst hatten und der Abgasgegendruck erheblich angestiegen war. Zur Reparatur mussten die Abgasanlage teilweise demontiert und der Sekundärschalldämpfer aufgetrennt werden.
Im Rahmen einer am 04.02.2003 durchgeführten Besprechung weigerte sich die Beklagte zu 1), die zur Schadensbeseitigung erforderlichen Arbeiten ohne gesonderte Vergütung im Rahmen ihres Wartungsvertrages auszuführen.
Am 13.03.2003 erstattete die T. mbH & Co. KG im Auftrag der Klägerin ihr schriftliches Gutachten (vgl. Anlage K 4, GA Bd. I Bl. 91 ff.) über mögliche Ursachen von Rissen und Bauteilverformungen an der Schalldämpferanlage zu Modul 2. Darin stellte Dr.-Ing. P. zwei voneinander unabhängige Ursachen fest: Einerseits seien Ermüdungsrisse an verschiedenen Stellen der mehrstufigen Schalldämpferanlage aufgrund der Verwendung eines Stahls (Werkstoff-Nr. 1.5415, sog. 16Mo3) aufgetreten, welcher für die Temperaturbereiche über 530 Grad Celsius nach den einschlägigen technischen Regeln nicht vorgesehen sei (künftig: unzureichende Werkstoffe); andererseits seien die bereits vorhandenen Ermüdungsrisse durch eine einmalige, schlagartige Belastung (Verpuffung) freigelegt und aufgeweitet worden. Zudem seien die Axialkompensatoren im Zusammenwirken mit ihren Halterungen für das vorliegende Rohrsystem ungeeignet, weil sie den beim Betrieb auftretenden Innendruckkräften nicht deformations- und verschiebungsfrei standzuhalten vermochten (künftig: unzureichende Elastizität der Systemkonstruktion).
Ungeachtet des Vorbehalts der Rückforderung kürzte die Klägerin die entsprechende Rechnung der Beklagten zu 1) vom 25.03.2003 für die Reparaturarbeiten am Modul 2 und zahlte lediglich 32.185,52 Euro.
Vorgerichtliche Mahnung:
Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 12.03.2003 (Anlage K 3, GA Bd. I Bl. 88 ff.) forderte die Klägerin die Beklagte zu 1) auf, bereits benannte und weitere Mängel bis zum 20.03.2003 zu beseitigen. Dies betraf die Ausführung der Sekundärschalldämpfer in niedrig legiertem Stahl und ohne Dämpfungsmaterial (zumindest am Modul 2), die erschwerte Reinigung des Mündungsschalldämpfers auf der Kaminspitze, die unzureichende Leistungsfähigkeit der Tischkühler, welche zu erhöhten Brennraumtemperaturen der Module bei Außentemperaturen über 25°C (im Sommer) und dadurch zu erhöhten Immissionen führe, den fehlenden Leistungsnachweis i.S.v. § 15 ZVB, Probleme bei der Ableitung der Oberwellen des Frequenzumformers (elektrotechnische Anlage), das fehlende automatische Zuschalten der fünf Module bei einem Wiederanlauf des BHKW nach einer kurzzeitigen Stromnetzstörung (sog. KU-Fähigkeit), das Auftreten von Feuchtigkeit in der Abgasstrecke sowie die übermäßige Schallentwicklung.
Die Beklagte zu 1) erklärte am 20.03.2003 den Verzicht auf die Einrede der Verjährung bis zum Ende des Kalenderjahres für solche Ansprüche, die zum Zeitpunkt der Erklärung nicht bereits verjährt waren (Anlage K 26, GA Bd. III Bl. 52).
Rechtsstreit:
Mit ihrer am 30.12.2003 beim Landgericht eingereichten und den Beklagten jeweils am 30.01.2004 zugestellten Klage hat die Klägerin gegen beide Beklagte als Gesamtschuldner einen Zahlungsanspruch i.H.v. 998.391,23 Euro nebst Verzugszinsen seit dem 20.03.2003 geltend gemacht (Klageantrag zu Ziffer 1) sowie gegen die Beklagte zu 1) einen weiteren Zahlungsanspruch i.H.v. 131.019,80 Euro (am 02.08.2004 korrigiert auf 133.018,84 Euro) sowie die Feststellung begehrt, dass die Beklagte zu 1) für die gesamte Laufzeit des Wartungsvertrages vom 20.05.1998 sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Regelwartungsleistungen für den im Vertrag genannten Wartungsumfang (einschließlich sämtlicher Reparaturen und des Ersatzes der verschlissenen Teile) auf eigene Kosten durchzuführen verpflichtet sei.
Die Klägerin hat den gegen beide Beklagte als Gesamtschuldner gerichteten Leistungsantrag zu Ziffer I. 1) i.H.v. 998.391,23 Euro ursprünglich auf Folgendes gestützt: Sie hat den fiktiven Mangelbeseitigungsaufwand für eine vollständige Neuerrichtung der gesamten Schalldämpferanlage i.H.v. 429.200,00 Euro brutto, die fiktiven, nach einem Angebot der Fa. Nießing (Anlage K 11) geschätzten Kosten für den Neuaufbau des Schornsteins i.H.v. 104.574,00 Euro brutto und die fiktiven Kosten für die erforderliche Anschaffung weiterer Tischkühler i.H.v. 40.904,84 Euro brutto beziffert. Sie hat auch die Kosten der Beseitigung der Mängel an der Elektrotechnik pauschal mit 10.000,00 Euro brutto angegeben. Auch insoweit hat sie einen Anspruch auf Ersatz der fiktiven Mangelbeseitigungskosten geltend gemacht. Darüber hinaus hat die Klägerin die (realen) Kosten des Abbaus des Mündungsschalldämpfers mit 2.861,15 Euro angegeben und hierzu zwei Rechnungen von Juli 2003 vorgelegt, die damit nicht in Übereinstimmung zu bringen sind (vgl. Anlagen K 14, K 15, GA Bd. I Bl. 148 f.). Soweit sie die Klage weiter auf die erforderliche Herstellung eines automatischen Wiederanlaufens der Module nach kurzzeitigen Stromnetzstörungen (sog. KU-Fähigkeit) sowie der hieraus resultierenden Schäden gestützt hat, hat sie angegeben, dass die Kosten noch nicht zu beziffern seien. Wegen der Nichterreichung der Leistungswerte hat sie eine Minderung i.H.v. 10 % der Auftragssumme, insgesamt 410.851,24 Euro brutto, geltend gemacht.
Zu Ziffer I. 2) der Klageschrift hat sie die Feststellung der Haftung der Beklagten zu 1) und zu 2) als Gesamtschuldner für weitere Schäden aus der fehlerhaften bzw. planwidrigen Erstellung des BHKW begehrt.
Mit ihrem Leistungsantrag zu Ziffer II. 1) auf Verurteilung der Beklagten zu 1) zu einer Zahlung in Höhe von 131.019,80 Euro hat die Klägerin bereicherungsrechtliche Ansprüche auf Rückzahlung von Vergütungen für Instandsetzungen – die von ihr unter Vorbehalt gezahlten Reparaturkosten nach dem Vorfall 2 i.H.v. 32.185,52 Euro sowie die Instandsetzungskosten 2001 und 2002 (Anlage K 21 sowie Anlagenkonvolute K 35, GA Bd. III Bl. 66 ff., und K 36, GA Bd. III Bl. 90 ff.) i.H.v. 35.674,60 Euro bzw. 63.159,68 Euro (später wegen eines Übertragungsfehlers korrigiert: 63.163,64 Euro), insgesamt später korrigiert auf 133.018,84 Euro – geltend gemacht.
Die Klägerin hat darüber hinaus zu Ziffer II.2 der Klageschrift einen Feststellungsantrag bezüglich der Leistungspflichten der Beklagten zu 1) aus dem Wartungsvertrag (einschließlich sämtlicher Reparaturen und Ersatz der Verschleißteile auf eigene Kosten) gestellt.
Die Klägerin hat sodann mit einer Klageerweiterung vom 20.07.2004 die realen Kosten des Austausches von drei Abgaswärmetauschern wegen auftretender Risse und Korrosionserscheinungen im Quartal IV des Jahres 2000 als Schadensersatzanspruch i.H.v. 107.139,65 Euro geltend gemacht (vgl. Rechnung Anlage K 42, KA I Bl. 1).
Mit ihrer Klageerweiterung vom 06.12.2004, am selben Tag direkt von Anwalt zu Anwalt an die Beklagte zu 1) zugestellt, hat die Klägerin einen Antrag auf Feststellung der Ersatzpflicht beider Beklagter als Gesamtschuldner für weitere Schäden aus der fehlerhaften und planwidrigen Erstellung des BHKW gestellt sowie einen weiteren Zahlungsantrag i.H.v. 32.644,98 Euro gegen die Beklagte zu 1). Den zuletzt genannten Zahlungsantrag hat sie darauf gestützt, dass die Beklagte zu 1) bei der Berechnung der Quartalsvergütung für die Wartung die Preisgleitklausel fehlerhaft angewandt habe, woraus sich für die Jahre 2001 bis 2003 eine Überzahlung in der vorgenannten Höhe ergeben habe.
Mit der Klageerweiterung vom 20.12.2004 hat die Klägerin den Zahlungsantrag zu Ziffer II 1) gegen die Beklagte zu 1) auf 146.296,77 Euro erhöht; insoweit hat sie den Rückforderungsanspruch weiter auf gezahlte Vergütungen für die Reparaturen an den Abgaswärmetauschern gestützt.
Schließlich hat die Klägerin mit Klageerweiterung vom 22.12.2009, der Beklagten zu 1) zugestellt am 08.02.2010, einen weiteren Zahlungsantrag gegen die Beklagte zu 1) i.H.v. 336.996,45 Euro wegen überzahlter Vergütungen für Reparaturen und den Ersatz von Verschleißteilen in den Jahren 2003 bis 2008 gestellt.
Die Klägerin hat im Schriftsatz vom 13.09.2004 (ab S. 16, GA Bd. IV Bl. 16 ff.) vorgetragen, dass sie die Abgasstrecke (zweistufiges Schalldämpfersystem und Abgaswärmetauscher) komplett neu gebaut habe – lediglich die im Jahre 2000 bereits ersetzten Abgaswärmetauscher habe sie weiterverwendet – und hierfür Kosten i.H.v. 484.475,91 Euro aufgewandt habe. Sie hat mit dem Anlagenkonvolut K 46 Rechnungen vorgelegt, welche einen Gesamtbetrag i.H.v. 484.456,06 Euro ergeben. Eine Änderung ihrer Klageanträge hat sie nicht vorgenommen.
Die Klägerin hat u.a. die Auffassung vertreten, dass sich aus dem Bauvertrag mit der Beklagten zu 1) ergebe, dass sämtliche Nachbesserungsarbeiten der Beklagten zu 1) in einem gemeinsamen förmlichen Abnahmetermin abzunehmen seien und erst danach der Lauf der Verjährungsfrist für diese Anlagenteile beginne. Zu diesem Abnahmetermin, der ursprünglich für den 28.03.2000 vorgesehen worden sei, sei es letztlich nicht gekommen, weil das BHKW nicht alle Leistungsparameter erfüllt habe. Hilfsweise hat sie sich teilweise auf ein arglistiges Verschweigen von Mängeln berufen.
Die Beklagte zu 2) hafte, weil sie ihrer Verpflichtung zur Bauüberwachung, welche eine Kontrolle der einzubauenden Einzelteile vor dem Verschluss der Anlage umfasste, verletzt habe. Ihr habe vor allem der Mangel an der Konstruktion der Sekundärschalldämpfer sowie an der Beschichtung des Schornsteins auffallen müssen. Hinsichtlich der Mängel der Beschichtung des Schornsteins sei die Beklagte zu 2) wissentlich zum Nachteil der Klägerin vom Leistungsverzeichnis abgewichen.
Die Beklagte zu 1) hat den Feststellungsantrag teilweise – exklusive Ersatz der verschlissenen Teile und mit Ausnahme solcher Maßnahmen der Instandhaltung, die auf unsachgemäße Benutzung, äußere Gewalt (wie Vandalismus) oder Fehlbedienung oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse oder höhere Gewalt zurückzuführen sind – sofort anerkannt (vgl. GA Bd. II Bl. 4). Im Übrigen haben beide Beklagte jeweils Klageabweisung beantragt.
Beide Beklagte haben – jeweils für sich – die Einrede der Verjährung erhoben.
Die Beklagte zu 1) hat mit Schriftsatz vom 29.04.2004 (GA Bd. II Bl. 84) Widerklage i.H.v. 139.958,58 Euro erhoben; dieser Schriftsatz ist der Klägerin am 21.05.2004 zugestellt worden. Sie hat die Widerklage auf Vergütungsforderungen aus drei Quartalsrechnungen für Wartungsarbeiten und vier Einzelrechnungen über Reparaturarbeiten gestützt.
Das Landgericht hat Beweis erhoben über einen Teil der Mangelbehauptungen der Klägerin durch die Hinzuziehung des Dipl.-Ing. H. Pe., von der IHK H. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von Maschinen und Anlagen, insbesondere Kraftwerkstechnik; wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf dessen schriftliches Gutachten vom 31.08.2009 (Gutachtenheft GH I) und dessen Anhörung im Termin am 24.02.2011 (GA Bd. VII Bl. 185 ff.) jeweils Bezug genommen.
Das Landgericht hat weiter Beweis erhoben zur Höhe des Schadens aus einer verminderten Leistung des BHKW; insoweit wird auf das schriftliche Ergänzungsgutachten desselben Sachverständigen vom 10.08.2012 verwiesen (Gutachtenheft GH II). Schließlich hat das Landgericht Beweis erhoben über den Inhalt des Vergabegesprächs am 07.05.1997 durch die Vernehmung des Zeugen C. R.; insoweit wird auf den Inhalt des Sitzungsprotokolls vom 10.01.2018 (GA Bd. IX Bl. 96 ff.) Bezug genommen. Das Landgericht hat die Klage mit seinem am 08.06.2018 verkündeten Urteil, welches am 30.07.2018 ergänzt worden ist, abgewiesen und die Klägerin auf die Widerklage zur Zahlung von 94.932,62 Euro unter Abweisung der Widerklage im Übrigen verurteilt.
Hinsichtlich des Komplexes I A (Gewährleistungsansprüche gegen die Beklagte zu 1)) hat das Landgericht für alle Mängel den Eintritt der Verjährung angenommen (LGU ab S. 47), wobei diese Beurteilung ganz wesentlich darauf gestützt wird, dass die Abrede der Parteien im Übergabeprotokoll vom 23.12.1997 als eine umfassende, sämtliche Gewährleistungsansprüche erfassende Novation ausgelegt worden ist. Deswegen könne sogar offenbleiben, ob die Klägerin hinsichtlich derjenigen Mängel, welche Gegenstand des Schiedsgutachtens gewesen seien, gehindert sei, außerhalb des Schiedsgutachtens Beweis für die Verantwortlichkeit der Beklagten zu erbringen (LGU S. 59 f.).
Hinsichtlich des Komplexes I B (Gewährleistungsansprüche gegen die Beklagte zu 2)) sei Verjährung eingetreten (LGU ab S. 61). Für die Bauüberwachung sei die Verjährung vor dem Ende des Jahres 2002 eingetreten, für die Begründung eines Sekundäranspruchs seien keine hinreichenden Ansatzpunkte vorgetragen worden. Für Mängel, die Gegenstand des Schiedsgutachtens gewesen seien, sei die Klägerin auf die Feststellungen des Schiedsgutachtens beschränkt (LGU S. 63 ff.).
Hinsichtlich des Komplexes II (Wartungsvertrag) ist das Landgericht davon ausgegangen, dass die Klägerin nicht habe beweisen können, dass jegliche Instandsetzungsleistungen einschließlich des Ersatzes von Verschleißteilen Gegenstand der pauschal vergüteten Leistungspflichten gewesen seien (LGU ab S. 73). Danach hat es der Klägerin die Rückerstattung von vier Zahlungen i.H.v. 3.440,17 Euro zugesprochen, welche jedoch durch die Hilfsaufrechnung der Beklagten zu 1) mit Wartungskosten für das I. Quartal 2009 untergegangen sei (LGU S. 80). Ein Anspruch auf Rückzahlung von Überzahlungen bestehe auch i.H.v. 32.644,98 Euro wegen der fehlerhaften Anwendung der Preisgleitklausel; insoweit sei jedoch mit der Widerklageforderung zu saldieren (LGU S. 80 f.).
Hinsichtlich der Widerklage hat das Landgericht die drei Quartalsrechnungen III und IV/2002 sowie I/2003 als unstreitig, drei Reparaturrechnungen (mit Ausnahme von B 18) als begründet angesehen (LGU S. 81 f.) und mit der vorgenannten Forderung der Klägerin saldiert. Die Hilfsaufrechnung der Klägerin gegen Schadensersatzansprüche wegen der fehlenden KU-Fähigkeit hat das Landgericht im Hinblick auf ein im April 2005 nachträglich vereinbartes Aufrechnungsverbot für unzulässig erachtet (LGU S. 82).
Gegen dieses, ihr am 14.06.2018 zugestellte Urteil wendet sich die Klägerin mit ihrer am 29.06.2018 eingelegten und – innerhalb der mehrfach, zuletzt bis zum 14.11.2018, verlängerten Frist – am 13.11.2018 begründeten Berufung.
Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass Gewährleistungsansprüche gegen die Beklagte zu 1) nicht verjährt seien, weil entgegen der Annahme des Landgerichts die Vereinbarung vom 23.12.1997 allenfalls den Beginn der Gewährleistungsfrist für die neue Gesamtanlage betroffen habe, nicht aber den in § 15 Abs. 3 Satz 2 ZVB und § 13 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B 1996 gleichermaßen geregelten besonderen Zeitpunkt des Beginns der Gewährleistungsfrist für nachgebesserte Anlagenteile.
Hinsichtlich der von der Beklagten zu 1) nach der förmlichen Abnahme der Gesamtanlage am 30.12.1997 ausgeführten Nachbesserungsarbeiten sei eine Abnahme (i.S. der vertraglich vereinbarten förmlichen Abnahme) gescheitert, so dass die Gewährleistungsfrist nicht zu laufen begonnen habe. Selbst wenn man jedoch den gescheiterten Abnahmetermin der Nachbesserung des Mangels am 28.03.2000 als Beginn der Frist ansehe, sei die Gewährleistungsfrist erst am 28.03.2003 vollendet gewesen. Die Klägerin wiederholt ihre erstinstanzliche Auffassung, dass äußerst hilfsweise eine Hemmung des Laufs der Verjährung bis zum 28.03.2000 im Hinblick auf die Durchführung der Nachbesserungsarbeiten (als ein Anerkenntnis i.S.v. § 208 BGB a.F. bzw. als ein Verhandeln i.S.v. § 204 BGB a.F.) eingetreten sei.
Hinsichtlich der im Mai 2000 angezeigten Mängel an dem Abgaswärmetauscher habe wegen § 13 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B eine gesonderte Verjährungsfrist von 36 Monaten ab Anzeige zu laufen begonnen.
Hinsichtlich der Mängel am Sekundärschalldämpfer – Verwendung von Stahl des Typs 16Mo3 statt von Edelstahl sowie planwidrige Konstruktion des Schalldämpfers – sei von einer arglistigen Täuschung auszugehen, weswegen der Schadensersatzanspruch einer Regelverjährung von 30 Jahren unterlegen habe. Das Landgericht habe zu Unrecht eine Beweislast der Klägerin dafür angenommen, dass ihr bzw. den für sie tätigen Ingenieuren Informationen über die beabsichtigten Änderungen nicht zugegangen seien. Die Klägerin meint, dass die bewussten Abweichungen vom Vertrag hier so gravierend gewesen seien, dass es weiterer Darlegungen von ihrer Seite nicht bedurft habe. Sie macht hilfsweise geltend, dass sie den Nachweis der nicht rechtzeitigen Vorlage der Schalldämpferzeichnung bewiesen habe, und äußerst hilfsweise, dass sie im Falle eines gerichtlichen Hinweises den Zeugen N. benannt hätte.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts seien die mit der Klage geltend gemachten Mängel bewiesen. Für den Nachweis sei die Klägerin prozessual nicht auf die Feststellungen des Schiedsgutachters beschränkt, weil dessen Gutachten grob unbillig und unbrauchbar sei. Für diesen Fall habe die Schiedsvereinbarung ausdrücklich vorgesehen, dass die Feststellungen weder endgültig noch verbindlich seien. Die Überschreitung des Grenzwertes des Herstellers der Module für den Abgasgegendruck sei von einer Unterauftragnehmerin der Beklagten zu 1) selbst regelmäßig festgestellt worden, so dass die Beklagte zu 1) diesen Mangel gar nicht wirksam bestreiten könne. Diese Grenzwertüberschreitung sei die zentrale Ursache für die Probleme bei der Schalldämmung; der Versuch der Nachbesserung durch den Einbau eines Mündungsschalldämmers habe zu einer Verstärkung des Abgasgegendrucks geführt.
Der Feststellungsantrag bezüglich der Einstandspflicht für künftige Schäden werde für erledigt erklärt, weil das BHKW inzwischen – unstreitig – abgebaut worden sei.
Hinsichtlich der Ansprüche gegen die Beklagte zu 2) sei Verjährung nicht eingetreten, weil der Sekundärhaftungsanspruch der Klägerin nicht verjährt gewesen sei. Die Beklagte zu 2) sei zudem auch zur Überwachung der Nachbesserungsmaßnahmen verpflichtet gewesen. Entgegen der Feststellung des Landgerichts habe die Beklagte zu 2) konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an ihrer eigenen pflichtgemäßen Bauüberwachung gehabt. So habe sie die von der Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1) angebrachten Mängelanzeigen erhalten (z.B. Anlage K 28: zu hoher Abgasgegendruck; Anlage K 31: Riss im Sekundärschalldämpfer) und gewusst, dass die Beklagte zu 1) die Leistungsnachweise nicht habe erbringen können (aus dem Schreiben ihrer Streithelferin, Anlage K 18: Hinweise auf Abgasgegendruck und Taupunktunterschreitungen als Ursache der mangelhaften Funktion). Hieraus habe u.a. schon der Schornsteinbauer Sch. (zutreffend) auf die Mangelursachen geschlossen (vgl. Anlage K 60).
Soweit das Landgericht darauf abgestellt habe, dass eine Hemmung der Verjährung durch das schiedsgutachterliche Verfahren bezüglich derjenigen Mängel eingetreten sei, welche Gegen stand des feststellenden Schiedsgutachtens gewesen seien, dies jedoch zu keinen Ansprüchen führe, weil die Klägerin bezüglich der Feststellung der Mangelhaftigkeit der Leistungen der Beklagten zu 2) auf die Feststellungen des Schiedsgutachtens beschränkt sei, trage die Begründung nicht. Die Klägerin rügt insoweit die Verletzung rechtlichen Gehörs. Entgegen der Auffassung des Landgerichts sei das Schiedsgutachten bezüglich der Mängel am Schornstein schon deswegen unbrauchbar, weil der Sachverständige hierzu gar keine Feststellungen getroffen habe. Im Übrigen habe das Landgericht verkannt, dass sich die Vertragsparteien darauf geeinigt hätten, dass das Gutachten schon dann unverbindlich sein solle, wenn es „unbrauchbar i.S.v. §§ 412, 493 ZPO“ sei. Das weitere, im Schiedsgutachten behandelte Problem seien Mängel im Bereich des Abgaswärmetauschers gewesen; insoweit habe der Schiedsgutachter verbindlich festgestellt, dass diese gerissen gewesen seien und dass die Korrosion an der Rauchgasseite begonnen habe, ohne dass der Grund hierfür habe festgestellt werden können. Dies sei jedoch ein isoliertes Problem gewesen, während es im jetzigen Rechtsstreit um ein komplexes Problem – die unzureichende Funktion des BHKW (z.B. unzureichende Lärmreduzierung) – gehe. Hierfür könne das Schiedsgutachten nicht verbindlich sein.
Die Klägerin wendet sich schließlich gegen die Auslegung des Wartungs- und Instandhaltungsvertrages durch das Landgericht, wonach Instandsetzungsleistungen von der Beklagten zu 1) nicht geschuldet waren und deswegen – mit Ausnahme des Austausches von Zündkerzen – ein gesonderter Vergütungsanspruch der Beklagten zu 1) bestand. Insoweit verweist sie insbesondere auf das Begriffsverständnis nach der DIN 31051, das übereinstimmende Verständnis der Vertragsparteien und allgemein der betroffenen Verkehrskreise.
Soweit das Landgericht den für begründet erachteten Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung i.H.v. 3.440,17 Euro im Hinblick auf eine Hilfsaufrechnung der Beklagten zu 1) als erloschen ansehe, habe es verkannt, dass diese Leistungen nicht gesondert zu vergüten gewesen seien. Auch habe das Landgericht die Tabelle (Anlage K 94) nicht unberücksichtigt lassen dürfen, weil sie selbst erklärend gewesen und von der Beklagten zu 1) nicht bestritten worden sei.
Bezüglich der Widerklage habe das Landgericht zu Unrecht drei Rechnungen (Anlagen B 19, B 20 und B 21) berücksichtigt (vgl. LGU S. 82); sie beträfen nicht gesondert vergütungspflichtige Leistungen. Die gegenüber den weiteren drei Rechnungen (Anlagen B 15, B 16 und B 17) erklärte Hilfsaufrechnung sei wirksam, weil sie bereits am 20.07.2004 erklärt worden sei. Der nachträglich geschlossene Vertrag habe das Erlöschen der Forderungen nicht mehr rückgängig machen können. Der Vertrag habe ein Aufrechnungsverbot auch nur für bis dahin nicht erklärte Aufrechnungen schaffen wollen.
Die Klägerin beantragt,
unter teilweiser Abänderung des erstinstanzlichen Urteils
1. die Beklagten zu 1) und zu 2) als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie 998.391,23 Euro nebst Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 20.03.2003 sowie weitere 107.139,65 Euro nebst Zinsen in Höhe von acht Pro zentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.07.2004 zu zahlen,
2. die Beklagte zu 1) weiter zu verurteilen, an sie 146.296,77 Euro nebst Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.12.2003 sowie weitere 32.644,98 Euro nebst Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 09.02.2010 zu zahlen,
3. die Beklagte zu 1) weiter zu verurteilen, an sie 336.996,45 Euro nebst Zinsen jeweils in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
aus 1.287,60 Euro seit dem 01.01.2004,
aus 28.617,23 Euro seit dem 01.01.2005,
aus 35.118,34 Euro seit dem 01.01.2006,
aus 65.042,51 Euro seit dem 01.01.2007,
aus 76.523,49 Euro seit dem 01.01.2008,
aus 60.359,30 Euro seit dem 01.01.2009 und
aus 70.047,98 Euro seit dem 01.11.2009
zu zahlen,
4. festzustellen, dass sich der ursprüngliche Feststellungsantrag bezüglich der Einstandspflicht der Beklagten zu 1) und zu 2) für weitere Schäden aus der fehlerhaften bzw. planwidrigen Erstellung des Blockheizkraftwerks im Hinblick auf den Abriss der Anlagen erledigt hat,
5. die Widerklage insgesamt abzuweisen.
Die Beklagte zu 1), die Beklagte zu 2) und die Streithelferin der Beklagten zu 2) beantragen jeweils,
die Berufung der zurückzuweisen.
Sie haben sich der Teil-Erledigungserklärung nicht angeschlossen und verteidigen im Wesentlichen das erstinstanzliche Urteil. Auf die Berufungserwiderung der Beklagten zu 1) vom 07.03.2019, der Beklagten zu 2) vom 28.02.2019 und der Streithelferin vom 04.03.2019 wird Bezug genommen. Der Senat hat am 29.06.2022 mündlich zur Sache verhandelt; wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt des Sitzungsprotokolls des Senats vom selben Tage Bezug genommen.
Zum Inhalt der Erörterung der Sach- und Rechtslage im Termin sowie zu den insoweit erteilten gerichtlichen Hinweisen auf die vorläufige Bewertung der Rechtssache haben die Klägerin mit ihrem Schriftsatz vom 15.07.2022 und die Beklagte zu 1) mit ihrem Schriftsatz vom 27.07.2022 ergänzend Stellung genommen.
B.
Die Berufung der Klägerin ist zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgemäß eingelegt und begründet worden. Sie hat in der Sache nur teilweise Erfolg.
Das Landgericht hat im Ergebnis zu Recht darauf erkannt, dass die Klägerin weder gegen die Beklagte zu 1) noch gegen die Beklagte zu 2) Gewährleistungsansprüche aus den jeweiligen Vertragsbeziehungen durchsetzen kann. Die Klägerin hat abweichend vom erstinstanzlichen Urteil umfangreichere bereicherungsrechtliche Ansprüche auf Rückzahlung überzahlter Vergütungen an die Beklagte zu 1), was zugleich zur Abweisung der Widerklage führt.
Zum Komplex I A:
I. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) ungeachtet der Einrede der Verjährung keinen Anspruch auf Schadensersatz bezüglich der Kosten für die Anschaffung zusätzlicher Tisch kühler in Höhe von 40.904,84 Euro (1.), der Kosten für die Beseitigung der fehlerhaften Signalweiterleistung bei der Frequenzumformung in Höhe von pauschal 10.000,00 Euro (2.) und der Kosten für den Neubau der Schornsteinanlage in Höhe von 104.574,00 Euro (3.), keinen Schadensersatzanspruch in Höhe von 410.851,24 Euro wegen fehlender Leistungsnachweise des elektrischen und thermischen Wirkungsgrades der Gesamtanlage (4.) und keinen Anspruch auf Ersatz der Kosten der Demontage des Mündungsschalldämpfers in Höhe von 2.861,15 Euro (5.). Ob ein Anspruch wegen unzureichender KU-Fähigkeit des BHKW besteht, kann hier offenbleiben (6.).
Hinsichtlich der Gewährleistungsansprüche der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) aus dem Bauvertrag vom 10.04./07.05.1997 sind ergänzend die Regelungen der VOB Teil B in der damals aktuellen Fassung von 1996 (künftig: VOB/B 1996) anzuwenden. Das ergibt sich entgegen der Auffassung der Beklagten zu 1) aus der Regelung in § 5 ZVB, wonach die VOB u.a. auch „hinsichtlich der Lieferung und Montage“ Gültigkeit erlangen sollte. Diese Regelung ist dahin auszulegen, dass die Vertragskonformität der Liefer- und Montageleistungen und damit deren Mangelfreiheit nach den Maßstäben der VOB/B zu beurteilen waren, was die Geltung des Gewährleistungsrechtes der VOB/B unmittelbar einschließt.
1. Für einen Gewährleistungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) wegen unzureichender Leistungsfähigkeit der Tischkühler fehlt es bereits an einer schlüssigen Darlegung eines Sachmangels, jedenfalls an dessen Nachweis. Unabhängig davon ist der mit dem Klageantrag geltend gemachte Anspruch auf Ersatz der fiktiven Aufwendungen für die Anschaffung weiterer Tischkühler zur Mangelbeseitigung in Höhe von 40.904,84 Euro brutto aus rechtlichen Gründen und deswegen nicht durchsetzbar, weil inzwischen wegen des Abrisses des BHKW eine Nachrüstung nicht mehr in Betracht kommt.
a) Die Klägerin hat mit ihrem Schriftsatz vom 12.03.2003 angezeigt, dass die jeweiligen Tisch kühler in der Energieerzeugungs- bzw. Energieumwandlungsanlage (Teilbereich 1 des BHKW) bei einer Außentemperatur von mehr als 25°C keine ausreichende Abkühlung der Brennraumtemperaturen in den Modulen gewährleisteten, was zu erhöhten Emissionen führte. Sie hat insbesondere behauptet, dass die Beklagte zu 1) zugesichert habe, dass ein Betrieb aller fünf Module des BHKW bei einer Außentemperatur von 32°C bis zu 90 % des Nennwerts gewähr leistet sei. Eine nach § 13 Nr. 1 VOB/B 1996 vorausgesetzte Abweichung der Werkleistung der Beklagten zu 1) von vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat die Klägerin jedoch nicht schlüssig darzulegen vermocht, jedenfalls ist sie beweisfällig geblieben.
aa) Eine entsprechende Zusicherung der Beklagten zu 1) war entgegen der Auffassung der Klägerin im Bauvertrag selbst nicht enthalten. Zwar sollte die Beklagte zu 1) im Rahmen ihres Angebotes nicht nur zusichern, dass die Kühlung einen Volllastbetrieb bei Außentemperaturen bis zu 25°C gewährleistet (was sie in ihrem Angebot getan hat), sondern sie sollte nach dem Leistungsverzeichnis, Abschnitt E1, S. 1-1-5 (vgl. GA Bd. I Bl. 72) auch Angaben dazu machen, wieviel Prozent des Nennwerts des Betriebes bei 30°C zugesichert werden. Insoweit trug die Beklagte zu 1) in ihrem Angebot jedoch keine Angaben ein und gab mithin keine Zusicherung ab. Die Klägerin erteilte den Auftrag letztlich auf dieses (unvollständige) Angebot, so dass es an einer Zusicherung eines bestimmten, ggf. nur anteiligen Betriebes des BHKW bei Außentemperaturen über 25°C fehlte.
bb) Eine Zusicherung des von der Klägerin behaupteten Inhalts ergibt sich auch nicht aus dem von der Klägerin in Bezug genommenen Schriftwechsel zwischen der Beklagten zu 1) und der Beklagten zu 2) während der Bauarbeiten. Allerdings schlug die Beklagte zu 2) in ihrem Schreiben an die Beklagte zu 1) vom 17.06.1997 (Anlage K 16, GA Bd. I Bl. 150 f.) vor, das Leistungsverzeichnis des Bauvertrages abzuändern und jeweils zwei parallele Tischkühler je Modul einzubauen, um nicht nur bei Außentemperaturen von 25°C einen 100 %-igen Betrieb zu gewährleisten, sondern auch bei Außentemperaturen von 32°C noch alle fünf Module – allerdings mit Leistungseinschränkungen – betreiben und ab 33°C den Betrieb des BHKW mit schrittweiser Abschaltung einzelner Module aufrecht erhalten zu können. Die Beklagte zu 1) nahm diesen Vorschlag aber nicht an, sondern unter breitete zwei alternative Gegenvorschläge mit ihrem Schreiben vom 18.06.1997 (Anlage B 10, GA Bd. II Bl. 53). Danach sollte die Motorenanlage entweder – gemäß dem Inhalt des Bauvertrages – lediglich auf einen Volllastbetrieb aller Module bei einer Außentemperatur von bis zu 25°C ausgelegt werden, was kostengünstiger und sicherer sei, aber beinhalte, dass seltene Einschränkungen bei höherer Außentemperatur hinzunehmen seien, oder die Anlage sollte auf einen Volllastbetrieb aller Module grundsätzlich bis zu einer Außentemperatur von 32°C ausgelegt werden, was den Einbau zusätzlicher Tischkühler erfordere. Auf den zuletzt genannten Gegenvorschlag Alternative 2 bezog sich das Angebot der Beklagten zu 1) über die Kosten der zusätzlichen Tischkühler in Höhe von 40.904,84 Euro (Anlage K 17). Das vorzitierte Schreiben der Beklagten zu 1) führte jedoch noch nicht zu einer entsprechenden Vereinbarung, sondern die Korrespondenz verblieb im Stadium wechselseitiger Vorschläge.
b) Selbst wenn ein Sachmangel der von der Klägerin behaupteten Art zur Zeit der Abnahme der Werkleistungen der Beklagten zu 1) vorgelegen hätte, wäre ein Anspruch der Klägerin auf Ersatz der Mangelbeseitigungskosten nicht in Betracht gekommen, denn die Mangelbeseitigung ist inzwischen unmöglich geworden. Das BHKW wurde bereits abgerissen, so dass eine Nachrüstung des Teilbereichs Energieumwandlung nicht mehr in Betracht kommt. Die Klägerin hat trotz des ausdrücklichen Hinweises des Senats im Termin vom 29.06.2022 auf diesen Umstand ihren Klageantrag nicht angepasst.
c) Schließlich ist darauf zu verweisen, dass ein Anspruch nach § 13 Nr. 5 Abs. 1 oder Abs. 2 VOB/B 1996 auf Ersatz der fiktiven Mangelbeseitigungskosten auch aus rechtlichen Gründen nicht in Betracht gekommen wäre. Auch hierauf ist die Klägerin ausdrücklich hingewiesen worden. Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat insoweit seine bisherige Rechtsprechung zur Bemessung des Schadensersatzanspruches statt der Leistung nach fiktiven Mangelbeseitigungskosten ausdrücklich aufgegeben (vgl. BGH, Urteil v. 22.02.2018, VII ZR 46/17, BGHZ 218, 1; bestätigt in: BGH, Beschluss v. 08.10.2020, VII ARZ 1/20, BauR 2021, 225). Diese Rechtsfrage ist im Termin der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erörtert worden.
2. Die Klägerin kann gegen die Beklagte zu 1) auch Gewährleistungsansprüche wegen einer unzureichenden Frequenzumformung nicht mit Erfolg geltend machen. Die hierauf bezogene Klageforderung in Höhe von pauschal 10.000,00 Euro brutto ist schon dem Grunde nach nicht gerechtfertigt, so dass es auf die unzureichende Substantiierung des Vortrags zur Höhe nicht ankommt.
a) Die Klägerin hat den erstmals im Schriftsatz vom 12.03.2003 bezeichneten Mangel schon nicht ordnungsgemäß angezeigt. Ihre damaligen Ausführungen beschränkten sich darauf, dass Oberwellen, welche bei der Frequenzumformung entstehen, nicht ordnungsgemäß abgeleitet werden würden, wodurch beim Betrieb des BHKW „die Messwerte“ beeinträchtigt würden. Diese Anzeige ist weder nachvollziehbar noch einlassungsfähig gewesen; mit ihr sind die Anforderungen an eine Mangelanzeige nicht erfüllt worden. Es ist nicht erkennbar, in welchem Bereich der Anlage derartige Frequenzumformungen auftreten, welche Soll-Beschaffenheit nach dem Vertrag geschuldet gewesen sein soll und wie bzw. inwieweit die Ist-Beschaffenheit hiervon abweichen soll oder welche Messwerte beeinträchtigt sein sollen. Der Mangel muss zumindest hinsichtlich seines äußeren objektiven Erscheinungsbildes so genau beschrieben werden, dass der Auftragnehmer zweifelsfrei ersehen kann, was im Einzelnen beanstandet wird bzw. welche Abhilfe von ihm verlangt wird (vgl. Wirth in: Ingenstau/Korbion, VOB Teile A und B, 21. Aufl. 2019, § 13 Abs. 5 VOB/B, Rn. 47 f. m.w.N.).
b) Selbst wenn der Senat das erstmals im Schriftsatz vom 06.05.2004 enthaltene Vorbringen der Klägerin, dass es Fehlfunktionen der Fühler für die Abgastemperatur am Ausgang der Abgaswärmetauscher der Module 3 und 5 gebe, dieser Mangelanzeige zuordnete, so läge zwar eine nachvollziehbare Mangelanzeige nach Klageerhebung ab dem 06.05.2004 vor. Die Mangelanzeige war aber jedenfalls nicht mit einer nach § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B 1996 voraus gesetzten fristgebundenen Aufforderung zur Mangelbeseitigung verbunden, sondern unmittelbar mit der Geltendmachung eines Anspruchs auf Ersatz der fiktiven Mangelbeseitigungskosten bei Selbstvornahme. Dieser Anspruch wäre mangels eines – auch nicht entbehrlichen – Mangelbeseitigungsverlangens mit angemessener Fristsetzung unbegründet.
c) Schließlich gilt auch im Hinblick auf diesen Mangel, dass ein Anspruch auf Ersatz von voraussichtlich erforderlichen, aber nicht aufgewandten, also fiktiven Mangelbeseitigungskosten nach der Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausgeschlossen ist; eine Umstellung der Klagebegründung ist trotz entsprechenden Hinweises nicht erfolgt.
3. Soweit die Klageforderung im Berufungsantrag zu Ziffer 1) auf Zahlung von 998.391,23 Euro einen Teilbetrag von 104.574,00 Euro brutto für den Neuaufbau der Schornsteinanlage enthält, ist die Klage schon unschlüssig, jedenfalls kommt ein Ersatz derartiger fiktiver Mangelbeseitigungskosten aus rechtlichen Gründen nicht in Betracht.
a) Die Klägerin hat in der Klageschrift vom 30.12.2003 Kosten für den Neuaufbau des Schornsteins in Höhe von 104.574,00 Euro brutto pauschal als Maßnahme „zur Behebung des Schallproblems“ bezeichnet (vgl. S. 9, GA Bd. I Bl. 9) und auf ein Angebot der Fa. I. GmbH vom 23.12.2003 (Anlage K 11, GA Bd. I Bl. 143 f.) Bezug genommen. Sie hat die Schallproblematik in der Klageschrift jedoch ausschließlich auf angebliche Mängel in der Abgasstrecke an den Primär- und insbesondere den Sekundärschalldämpfern gestützt, ohne einen für die Schallproblematik relevanten Mangel der Schornsteinanlage auch nur zu benennen. Sie hat die Ausführungen zur Höhe mit der Bemerkung eingeleitet, dass eine Mangelbeseitigung technisch nur möglich sei durch den Neuaufbau der Schalldämpferanlage; hierzu gehört die Schornsteinanlage jedoch nicht. Auch im weiteren Verlauf des Rechtsstreits sind Mängel der Schornsteinanlage, welche zu erhöhten Schallleistungspegeln hätten führen können, nicht vorgetragen worden.
b) Allerdings ist darauf zu verweisen, dass in der Klageschrift vom 30.12.2003 im sachlichen Zusammenhang mit dem Mangelkomplex „Mündungsschalldämpfer“ auch Mängel erstmals angezeigt werden, welche nicht den Mündungsschalldämpfer, sondern die Schornsteinanlage im Allgemeinen betroffen haben (Klageschrift S. 10). Die Klägerin hat vorgetragen, dass Ende März 2003 ein zu hoher Kondensat-Rücklauf im Schornstein festgestellt worden, ein Defekt in der Kondensatleitung im Bereich der Durchführung durch den Tragmantel des Schornsteins und eine unzureichende Dämmdicke im Inneren des Schornsteins, weil die Isolierung im Schornstein lediglich 1x 50 mm stark sei statt 2x 50 mm und der Tragmantel innen lediglich eine Grundierung statt einer Grundierung mit einer Deckbeschichtung jeweils aus Epoxidharz Eisenglimmer aufweise. Die Klägerin selbst leitete jedoch aus diesem Mangel keinen Anspruch auf Neuherstellung der Schornsteinanlage ab und trug insbesondere auch nichts dazu vor, dass die angezeigten Mängel eine vollständige Neuherstellung der Schornsteinanlage erforderten. Selbst wenn der Senat den vorgenannten Sachvortrag der Teilforderung von 104.574,00 Euro zuordnete, hätte die Klage insoweit keinen Erfolg.
c) Auch die Teilforderung von 104.574,00 Euro brutto bezieht sich auf fiktive Mangelbeseitigungskosten, deren Ersatz nach den Vorausführungen schon aus rechtlichen Gründen nicht in Betracht kommt.
4. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) hat gegen die Beklagte zu 1) keinen Anspruch auf Zahlung von 410.851,24 Euro brutto wegen der Nichteinhaltung von vereinbarten Leistungsparametern des BHKW.
a) Soweit die Klägerin diesen Anspruch als „Minderung“ bezeichnet, geht der Senat von einer Falschbezeichnung aus; die Klägerin stützt ihren Anspruch auf §§ 15, 19 ZVB des Bauvertrages, welche auf einen pauschalierten Schadensersatzanspruch in Höhe von 10 % des Auftragswerts gerichtet sind. Weder aus dieser Anspruchsgrundlage noch aus § 13 Nr. 7 Abs. 3 lit. c VOB/B 1996 ist der Anspruch gerechtfertigt.
b) Eine als Sachmangel zu qualifizierende Abweichung der Ist-Beschaffenheit des BHKW gegenüber der Soll-Beschaffenheit ist nicht feststellbar.
aa) In dem Leistungsverzeichnis, welches Vertragsbestandteil wurde, dort unter Technische Daten, Seite A – 2 (GA Bd. I Bl. 35), wurden unter Ziffer 3.1 Quantitative Daten „nur Richtwerte“ zwingend vorgegeben: elektrische Leistung BHKW maximal 6.000 kW, thermische Leistung BHKW maximal 8.000 kW, sowie unter Ziffer 3.2 Qualitative Daten nur unvollständige Vorgaben gemacht: Volllaststunden 6.000 Bh/a, elektrischer Wirkungsgrad 38,5 % brutto, thermischer Wirkungsgrad k.A. (also: keine Angabe). Im Hinblick auf die Soll-Beschaffenheit war § 13 Abs. 2 Satz 5 ZVB einschlägig, wonach der Nachweis zugesicherter Eigenschaften während des Probebetriebes stattfinden sollte. Diese Regelung wurde durch § 15 Abs. 1 ZVB dahin ergänzt, dass im Falle der Unmöglichkeit des Nachweises im Probebetrieb der Leistungsnachweis innerhalb von vier Monaten nachzuholen sei, und durch § 15 Abs. 3 ZVB, aus dem sich ergab, dass der Auftragnehmer erst im Falle einer erfolglosen zweiten Nachbesserung schadensersatzpflichtig i.S.v. § 19 ZVB sei. In der Gesamtschau dieser vertraglichen Regelungen ergibt sich, dass eine Schadensersatzhaftung der Beklagten zu 1) allenfalls bezüglich des Nichterreichens des elektrischen Wirkungsgrades im Leistungsnachweis in Betracht kam. Die Schadensersatzregelungen für den Fall des Nichterreichens des thermischen Wirkungsgrades gingen mangels verbindlicher Festlegungen ins Leere.
bb) Zwar wurde anlässlich der förmlichen Abnahme am 30.12.1997 festgestellt, dass der Leistungsnachweis des elektrischen Wirkungsgrades noch nicht erbracht worden und binnen vier Wochen nachzuholen sei (vgl. Ziffer 5 des Protokolls, Anlage B 1, GA Bd. II Bl. 29). Soweit die Beklagte zu 1) unter Berufung auf das Telefax der Streithelferin der Beklagten zu 2) vom 16.01.1998 (Anlage B 11, GA Bd. II Bl. 58) die erfolgreiche Durchführung einer entsprechenden Leistungsfahrt behauptet hat, folgt der Senat dem nicht, denn dieses Schreiben enthielt lediglich die Bitte um Übergabe der Auswertung der Leistungsfahrt, aber keinen Hinweis auf deren Ergebnis und erst recht keinen Beleg dafür, dass die Beklagte zu 1) dieser Aufforderung nachgekommen sei und welches Ergebnis die Leistungsfahrt hatte. Dies genügt für den von der Beklagten zu 1) als Auftragnehmerin vorzulegenden schriftlichen Leistungsnachweis nicht. Es ist nicht zu beanstanden, dass das Landgericht auf eine Vernehmung der von der Beklagten zu 1) angebotenen Zeugen verzichtet hat, denn Zeugenaussagen über die Durchführung einer Leistungsfahrt können weder den fehlenden schriftlichen Leistungsnachweis noch die wertende Beurteilung durch die Auftraggeberin bzw. deren Vertreterin ersetzen. Die Klägerin hat jedoch selbst das an sie gerichtete Schreiben der Streithelferin der Beklagten zu 2) vom 07.09.1999 (Anlage K 18, GA Bd. I Bl. 153) vorgelegt, wonach zunächst am 24.08.1999 ein Test unzureichende Leistungswerte ergeben habe, es aber offenbleibe, ob hierfür technische oder meteorologische Einflüsse maßgeblich gewesen seien, während am 25.08.1999 ein weiterer Probelauf akzeptable Ergebnisse („als unterste Toleranzgrenze“) erbracht habe. In der Zeit nach dem 07.09.1999 folgte keine Anzeige eines Fehlens des Leistungsnachweises mehr, so dass der Senat in der Gesamtschau eine Erbringung des Leistungsnachweises über einen vertragsgemäßen elektrischen Wirkungsgrad feststellt.
5. Schließlich ist auch ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklage zu 1) auf Ersatz der (tat sächlich angefallenen) Kosten des Abbaus des Mündungsschalldämpfers in Höhe von 2.861,15 Euro nicht begründet.
a) Zunächst ist darauf zu verweisen, dass die Einfügung eines Mündungsschalldämpfers am Kopf des Kamins keine originäre vertragliche Leistung nach dem Bauvertrag der Parteien war, sondern eine zwischen ihnen vereinbarte Maßnahme der Mangelbeseitigung im Hinblick auf die Lärmemissionen des BHKW. Der Einbau beruhte auf einem Vorschlag der Beklagten zu 1) im Schreiben vom 08.01.1998 (Anlage K 13, GA Bd. I Bl. 147) und einer Zustimmung der Klägerin – unter nachträglich erfüllten Vorbehalten – im Schreiben vom 10.01.1998 (Anlage K 12, GA Bd. I Bl. 146). Der Einbau erfolgte im Januar 1999 und führte zumindest vorübergehend auch zu einer Verminderung der Lärmemissionen.
b) Der Senat geht bezüglich des Mündungsschalldämpfers von einer konkludenten Abnahme durch Inbetriebnahme und fortlaufende Nutzung ab Februar 1999 aus. Für diese Maßnahme war eine isolierte förmliche Abnahme nicht vereinbart worden. Hilfsweise ist von einem konkludenten Verzicht der Klägerin auf eine förmliche Abnahme auszugehen. Hierauf kommt es für die Entscheidung in der Hauptsache letztlich nicht an.
c) Die Klägerin zeigte erstmals Ende März 2003, nach der Herstellung eines Zugangs zum Inneren des Kamins als sog. Mannloch im Schornsteinpodest, die Verwendung eines unzureichenden Werkstoffs für den Mündungsschalldämpfer und einen Konstruktionsfehler von dessen Kulissen gegenüber der Beklagten zu 1) an. Die Klägerin traf jedoch keine Auswahlentscheidung zwischen den ggf. in Betracht kommenden Gewährleistungsansprüchen und sie forderte die Beklagte zu 1) auch nicht etwa zur Beseitigung der angezeigten Mängel auf, sondern entschied sich unmittelbar für die endgültige Demontage des Mündungsschalldämpfers. Danach sind weder die Voraussetzungen des § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B 1996 noch diejenigen des § 13 Nr. 7 VOB/B 1992 erfüllt.
6. Für die Entscheidung des Rechtsstreits in der Hauptsache kann offenbleiben, ob die Klägerin gegen die Beklagte zu 1) einen Anspruch auf Schadensersatz, insbesondere nach § 13 Nr. 7 Abs. 2 VOB/B 1996, wegen des fehlenden Nachweises der KU-Fähigkeit des BHKW hat.
a) Die Klägerin hat im Zusammenhang mit ihren Ausführungen, warum sie im Jahre 2000 zu einer Gesamtabnahme der Mangelbeseitigungsmaßnahmen noch nicht bereit gewesen sei, eine unzureichende Funktion der Gesamtanlage bezüglich des Wiederanlaufens des BHKW nach kurzzeitiger Stromnetzstörung bzw. nach Einspeiseunterbrechung beanstandet, insbesondere hat sie eine automatische Zuschaltung der Module vermisst. Sie hat im Verlaufe des Rechtsstreits vorgetragen, dass dieser Mangel seit dem Jahre 2004 „in geminderter Form“ fortbestehe, ohne dies näher zu konkretisieren. Mit ihrem Schriftsatz vom 13.09.2004 (dort ab S. 22, GA Bd. IV Bl. 22) hat sie auf (Folge-) Schäden durch Personalmehrkosten wegen erforderlicher manueller Zuschaltungen und durch entgangenen Gewinn aus der Stromeinspeisung (später auch aus der Fernwärmeeinspeisung) verwiesen. Mit ihrem Schriftsatz vom 04.08.2008 hat sie den durchschnittlichen (Folge-) Schaden je Kurzunterbrechung in Höhe von 1.036,00 Euro beziffert und behauptet, dass im Zeitraum von 1998 bis 2008 insgesamt 312 Kurzunterbrechungen aufgetreten seien, woraus sie einen Gesamtschaden in Höhe von 323.232,00 Euro ermittelt hat.
b) Die Beklagte zu 1) hat nicht bestritten, dass es sich bei dem anlässlich der Abnahme vom 30.12.1997 vorbehaltenen Mangel (vgl. Ziffer 5.3: „… automatische Wiederzuschaltung der Module nach kurzzeitiger Stromnetzstörung herstellen – schnellstmöglich“) um das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft handelt. Sie hat eine Beseitigung dieses Mangels im Verlaufe des Jahres 1999 zwar behauptet, aber nicht nachgewiesen. Insoweit stehen der Behauptung der Beklagten zu 1) allerdings nicht die von der Klägerin angeführten Abnahmeverlangen der Beklagten entgegen; weil das Abnahmeverlangen der Beklagten zu 1) vom 19.10.1998 (Anlage K 22, GA Bd. III Bl. 25) zeitlich vor der angeblichen Mangelbeseitigung lag und das Abnahmeverlangen der Beklagten zu 1) vom 10.03.2000 (Anlage K 23, GA Bd. III Bl. 26) sich auf die Abnahme „der Restpunkte“ bezog, ohne dass es einen Hinweis auf die noch offene Abnahme der KU-Fähigkeit beinhaltete. Auch das Schreiben der Beklagten zu 2) an die Beklagte zu 1) vom 18.05.2000 (Anlage K 27, GA Bd. III Bl. 53) ist insoweit unergiebig, denn es bezog sich nicht auf das Wiederanlaufen nach einer Unterbrechung, sondern allgemein auf die Ergebnisse eines Tests „des Automatikbetriebes“, ohne den Gegenstand des Tests näher zu spezifizieren. Maßgeblich ist jedoch, dass die Beklagte zu 1) kein Dokument vorlegen kann, aus dem sich auf die Nachholung der Prüfung der KU-Fähigkeit und auf ein positives Ergebnis dieses Leistungsnachweises schließen lässt. Vielmehr spricht gegen einen Leistungsnachweis, dass die Klägerin den ausstehenden Test der KU-Fähigkeit auch in ihrem Schriftsatz vom 12.03.2003 beanstandete und die Mängel- und Restleistungsliste vom 28.03.2003 (Anlage B 5, GA Bd. II Bl. 44), welche die Beklagte zu 1) nicht zurückgewiesen hatte, auswies, dass die Prüfung des Automatikbetriebes unvollständig sei, weil die KU-Festigkeit noch geprüft werden müsse.
c) Ob die Klägerin gegen die Beklagte wegen dieses Mangels einen Gewährleistungsanspruch hat, muss der Senat nach den im Berufungsverfahren gestellten Anträgen nicht entscheiden. Denn der o.g. Betrag für Folgeschäden aus der unzureichenden KU-Fähigkeit in Höhe von 323.232,00 Euro bzw. auch ein anderer Geldbetrag werden von einem Leistungsantrag der Klägerin nicht erfasst. Bei der Berechnung der Klageforderungen wird eine Position Schadensersatz wegen fehlenden Nachweises der KU-Fähigkeit nicht aufgeführt. Die Summe des Berufungsantrages zu Ziffer 1, der auf Zahlung von insgesamt 998.391,23 Euro gerichtet ist, setzt sich zusammen aus den Kosten für die Neuerrichtung der Abgasstrecke (seinerzeit fiktiv 429.200,00 Euro), den Kosten für die Neuerrichtung der Schornsteinanlage (fiktiv 104.574,00 Euro), den Kosten der Anschaffung weiterer Tischkühler (fiktiv 40.904,84 Euro), den Kosten der Mangelbeseitigung bei der Frequenzumformung (fiktiv 10.000,00 Euro), dem Schadensersatz wegen des Nichterreichens der zugesicherten Wirkungsgrade des BHKW (410.851,24 Euro) und den Kosten der Demontage des Mündungsschalldämpfers (2.861,15 Euro). Soweit die Schadensposition wegen der unzureichenden KU-Fähigkeit Gegenstand des erst am 06.12.2004 rechtshängig gewordenen Feststellungsantrages der Klägerin geworden sein könnte, hat die Klägerin diesen Antrag nach dem Abriss des BHKW einseitig für erledigt erklärt.
II. Ebenfalls ungeachtet der Streitfrage der Verjährung von Gewährleistungsansprüchen ist ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) wegen einer Überschreitung des maximalen Schallleistungspegels, gemessen am Ausgang der Schornsteinanlage, nicht (mehr) gegeben. Dieser Mangel wurde erfolgreich beseitigt.
1. Das zum Vertragsbestandteil gewordene Leistungsverzeichnis des Bauvertrages enthielt funktionale Anforderungen an die Schalldämpfung des BHKW, darunter zwei Schallleistungspegel, jeweils bezogen auf eine Messung im Mündungsquerschnitt des Schornsteins. Danach wurde vereinbart, dass beim Betrieb aller fünf Module ein maximaler Schallleistungspegel von 78 dB(A) auftreten durfte (vgl. Abschnitt D, Garantiedaten, Erklärungen des Bieters, D-5, GA Bd. I Bl. 60), und weiter, dass beim Normalbetrieb lediglich eines Moduls ein maximaler Schallleistungspegel von 71 dB(A) einzuhalten war (vgl. Abschnitt E, Fabrikatsangaben M., S. 1- 1-8 (GA Bd. I Bl. 75). Nach dem Bauvertrag war die Beklagte zu 1) verpflichtet, die Einhaltung dieser maximalen Schalleistungspegel gegenüber der Klägerin nachzuweisen.
2. Dieser Nachweispflicht kam die Beklagte zu 1) jedenfalls bis einschließlich zum Termin der förmlichen Abnahme am 30.12.1997 nicht nach. Die Klägerin zeigte vielmehr das Vorliegen zu hoher Schallemissionen als Mangel bereits vor der förmlichen Abnahme am 30.12.1997 an und erklärte anlässlich der Abnahme ausdrücklich einen entsprechenden Vorbehalt. In der Mangel- und Restpunkteliste wurde unter Ziffer 5.1 die Notwendigkeit der Beseitigung zu hoher Schallemissionen gemäß noch ausstehender Messungen festgehalten.
3. In der Gesamtwürdigung des Prozessstoffes ist festzustellen, dass die Beklagte zu 1) den vorgenannten Mangel erfolgreich behob.
a) Allerdings ist davon auszugehen, dass sämtliche Nachbesserungsmaßnahmen der Beklagten zu 1) bis einschließlich November 1998 nicht zur einer Mangelbeseitigung führten. Insbesondere wurde die Überlegung, zusätzliche Schalldämpfer in der Abgasstrecke zu installieren, nach mehrfacher technischer Prüfung verworfen, weil die entsprechenden Arbeiten mit erheblichen Ausfällen des BHKW verbunden gewesen wären.
b) Im Dezember 1998 trafen die Vertragsparteien durch wechselseitige Schreiben und schließlich durch die Ausführung der Maßnahme eine Einigung des Inhalts, dass der angezeigte Man gel durch den Einbau eines Mündungsschalldämpfers behoben werden sollte und der Erfolg der Mangelbeseitigung durch eine durch einen externen Sachverständigen durchgeführte Messung bestätigt werden sollte.
Zunächst bot die Beklagte zu 1) mit ihrem Schreiben vom 08.12.1998 (Anlage K 13, GA Bd. I Bl. 147) zur Einhaltung des maximalen Schallleistungspegels im Mündungsquerschnitt der Schornsteinanlage den Einbau eines zusätzlichen Mündungsschalldämpfers an. Das Angebot der Beklagten zu 1) schloss damit, dass der Nachweis über den Erfolg der durchgeführten Maßnahme mittels einer Schallmessung geführt werden solle. Das Angebot ist dahin auszulegen, dass eine weitere Ursachenforschung für die Schallproblematik nicht erfolgen sollte, sondern eine zur Einhaltung der Maximalwerte führende Installation des Mündungsschalldämpfers als finale Maßnahme zur Mangelbeseitigung angeboten wurde.
Die Klägerin stimmte diesem Vorschlag mit ihrem Schreiben vom 10.12.1998 (Anlage K 12, GA Bd. I Bl. 146) unter dem Vorbehalt der schriftlichen Zusage von mehreren Bedingungen zu (die Verantwortung der Beklagten zu 1) für das Genehmigungsverfahren, die Übernahme sämtlicher in Betracht kommender Anpassungskosten, z.B. für eine Fundamentverstärkung, die Übernahme der Kosten eines Sachverständigen für die Schallmessung sowie das Recht der Klägerin zur Zurückweisung der Maßnahme für den Fall der Nichteinhaltung der Schallwerte). Im Hinblick auf ihr Zurückweisungsrecht verlangte die Klägerin, dass nach einer erfolgreichen Schallmessung am Schalldämpfer lediglich eine vorläufige Abnahme erfolge und dass eine endgültige Abnahme im April 1999 stattfinden solle, bei welcher die Korrosionsbeständigkeit und Eignung des Mündungsschalldämpfers im Dauerbetrieb bewertet werden solle. In dieser Erklärung lag eine Ablehnung des Angebots der Beklagten zu 1) und die Unterbreitung eines neuen, modifizierten Angebots.
Mit Schreiben vom 14.12.1998 (Anlage K 100, KA Bd. 1, Bl. 173) informierte die Beklagte zu 1) die Klägerin über den Gang des von ihr betriebenen Genehmigungsverfahrens und den Umstand, dass bauliche Änderungen an den Bestandsanlagen nicht erforderlich seien. Hieraus ergab sich, dass die Beklagte zu 1) jedenfalls die beiden zuerst genannten Modifikationen der Klägerin akzeptierte. Das spätere Verhalten der Beklagten zu 1) ist auch dahin auszulegen, dass sie sich mit der dritten Modifikation – Übernahme von Sachverständigenkosten – einverstanden erklärte. Im Hinblick auf das Zurückweisungsrecht der Klägerin verblieb die Beklagte zu 1) jedoch bei ihrem ursprünglichen Angebot, indem sie schrieb: „Wie bereits in unserem Schreiben vom 08.12.1998 mitgeteilt, wird die Wirksamkeit der Maßnahme durch eine Schallmessung belegt.“ (Unterstreichung durch den Senat). Damit brachte die Beklagte zu 1) unmissverständlich zum Ausdruck, dass der Einbau eines Mündungsschalldämpfers ein- schließlich der Übernahme der Kosten des Genehmigungsverfahrens und der sachverständigen Messung als Mangelbeseitigungsmaßnahme unter der Bedingung angeboten wurde, dass der Erfolg der Mangelbeseitigung allein von einer einmaligen Leistungsfahrt mit Schallpegelmessung abhing.
Nachdem die behördliche Genehmigung im Januar 1999 erteilt wurde, erfolgte der Einbau des Mündungsschalldämpfers durch die Beklagte zu 1) an der Schornsteinanlage der Klägerin mit deren Duldung Ende Januar/Anfang Februar 1999. Hierin sieht der Senat eine Annahme des nochmals modifizierten Angebots der Beklagten zu 1) vom 14.12.1998.
c) Am 22.02.1999 fand eine Schallpegelermittlung statt, welche ohne Beanstandungen blieb. Unter dem 23.02.1999 erstatteten Dipl.-Ing. G. und Dipl.-Phys. Sp. ein Gutachten (Nr. 1024E1/1999, Anlage B 4, GA Bd. II Bl. 40 ff.), welches einen Schallleistungspegel an der Schornsteinmündung von 77 bis 78 dB(A) auswies. Die Klägerin holte ein weiteres Schallgut achten ein, welches im Prozess nicht vorgelegt worden ist und zu dessen Ergebnis sich die Klägerin nicht geäußert hat. Der Senat würdigt dieses Prozessverhalten dahin, dass das Gut achten keine zu Ungunsten der Beklagten zu 1) abweichenden Erkenntnisse enthielt. Damit war der Nachweis der Beseitigung des Mangels „Überschreitung des maximalen Schallleistungspegels am Ausgang der Schornsteinanlage“ erbracht. Darauf, ob weitere Schallprobleme bei isolierter Betrachtung der Abgasstrecke vorlagen oder ob andere, eigenständige Mängel, etwa die unzureichende Korrosionsbeständigkeit des Mündungsschalldämpfers, bestanden, kam es für die Bewertung der Mangelbeseitigung nicht an. Insoweit ist klarzustellen, dass zwar die Anzeige des Mangels der Nichteinhaltung des maximalen Schallleistungspegels am Aus gang der Schornsteinanlage des BHKW grundsätzlich alle Sachmängel der Anlage erfasste, welche eine erhebliche Erhöhung dieses Schallleistungspegels verursachten, also z.B. auch die später entdeckten Mängel an den Sekundärschalldämpfern (Ausfluss der sog. Symptomtheorie des Bundesgerichtshofes, vgl. nur Wirth, a.a.O., § 13 Abs. 5 VOB/B Rn. 47 m.w.N.). Hiervon zu unterscheiden ist jedoch, die Beseitigung welchen Mangels die Auftragnehmerin anzeigt und die Auftraggeberin als nunmehr vertragsgerechte Leistungserbringung anerkennt. Die Abnahme des Mündungsschalldämpfers als erfolgreiche Maßnahme zur Erreichung einer Funktionalanforderung – maximaler Schallleistungspegel am Ausgang der Schornsteinanlage – führte auch nicht etwa zu einer Schlechterstellung der Klägerin bei der Geltendmachung hiervon abweichender Mängel.
d) Dem entsprechend zeigte die Beklagte zu 1) gegenüber der Klägerin mit ihrem Schreiben vom 24.03.1999 (in Anlagenkonvolut K 24, GA Bd. III Bl. 48) die Erledigung der Schallproblematik BHKW zu Ziffer 5.1 der Mängel- und Resteleistungsliste an, was die Klägerin unwidersprochen hinnahm. Die Klägerin zeigte danach auch keinen Mangel mehr im Hinblick auf den Schallleistungspegel am Ausgang der Schornsteinanlage an, so war z.B. in der Mängel- und Resteleistungsliste der Streithelferin der Beklagten zu 2) vom 28.03.2000 (Anlage B 5, GA Bd. II Bl. 44, als Anlage nur Seite 1 von 3 vorgelegt, vollständige Vorlage im Termin vom 02.08.2004, jedoch nicht zur Gerichtsakte genommen) kein Eintrag mehr zu einem schalltechnischen Mangel enthalten, in der Besprechung vom 28.05.2000 über offene Restleistungen fand die Schallproblematik keine Erwähnung mehr (vgl. Anlage B 6, GA Bd. II Bl. 45 f.).
e) Nur vorsorglich ist darauf zu verweisen, dass der Annahme des Senats, wonach der Mangel der Überschreitung des maximalen Schallleistungspegels laut Leistungsbeschreibung endgültig beseitigt wurde, nicht entgegensteht, dass die Abnahme einzelner Nachbesserungsmaßnahmen von einer nochmaligen förmlichen Gesamtabnahme des BHKW durch die Klägerin abhängig gewesen wäre. Diese von der Klägerin vertretene Rechtsauffassung findet – ungeachtet der nachfolgenden Ausführungen – selbst im ursprünglichen Bauvertrag keine Stütze. Der Bauvertrag sah in § 14 Abs. 1 ZVB eine förmliche Abnahme der Gesamtleistung vor, wie sie am 30.12.1997 auch erfolgte. Die Regelung des § 15 Abs. 3 Satz 2 ZVB ist dahin auszulegen, dass für nachgebesserte Anlagenteile jeweils eine Teilabnahme zulässig und aus schlaggebend für den Beginn der Gewährleistungsfrist des § 17 ZVB sein sollte. Die von der Klägerin während der gesamten Phase der Nachbetreuung des Bauwerks geforderte nochmalige Gesamtabnahme des BHKW war weder ausdrücklich vereinbart noch konnte die vorgenannte Regelung in diesem Sinne interpretiert werden. Nach ihrem objektiven Erklärungswert i.S.v. §§ 133, 157 BGB wurden selbständige Teilabnahmen für jedes nachgebesserte Anlagenteil vorgesehen, welche dann jeweils von der Gewährleistungsfrist der Gesamtanlage abweichende Einzel-Gewährleistungsfristen in Gang setzen sollten. Ausgehend von diesem Vertragsverständnis war für die Einzelabnahmen für nachgebesserte Anlagenteile weder eine förmliche Abnahme vorgesehen noch gar eine Wiederholung der Abnahme der Gesamtanlage.
III. Etwaige Gewährleistungsansprüche gegen die Beklagte zu 1) wegen Sachmängeln an der mehrstufigen Schalldämpferanlage des BHKW i.H.v. 429.200 Euro bzw. weiteren 107.139,65 Euro kann die Klägerin gerichtlich nicht mehr durchsetzen, weil die Beklagte zu 1) wegen des Eintritts der Verjährung nach § 214 Abs. 1 BGB dauerhaft zu einer Leistungsverweigerung berechtigt ist.
0. Im Hinblick auf den Berufungsantrag zu Ziffer 1 ist nach dem Vorausgeführten nur noch über die Position Neubau der Schalldämpferanlage zu befinden; insoweit hat die Klägerin zunächst einen Betrag in Höhe von 429.200,00 Euro brutto fiktive Kosten der vollständigen Neuerrichtung der Schalldämpferanlage geltend gemacht – was rechtlich nicht (mehr) zulässig ist – und mit ihrem Schriftsatz vom 13.09.2004 eine endgültige Abrechnung der Ersatzvornahme vorgenommen, welche laut Sachvorbringen auf 484.475,91 Euro brutto endete (vgl. GA Bd. IV Bl. 16). Nur vorsorglich ist anzumerken, dass der Klage- bzw. Berufungsantrag zu Ziffer 1 nicht angepasst wurde und dass sich die Summe der im Anlagenkonvolut K 46 in Bezug genommenen Fremdrechnungen auf 484.456,06 Euro beläuft (vgl. GA Bd. IV Bl. 17 f. und Bd. IV Bl. 60 ff.)). Der Senat hat die Klägerin im Termin vom 29.06.2022 hierauf hingewiesen, von einer weiteren Aufklärung jedoch abgesehen. Diese Schadensposition wird aus zwei Mangelkomplexen her geleitet:
a) Die Klägerin beanstandet einerseits die Überschreitung des Grenzwerts des Herstellers der Motoren zu dem auf die Motoren wirkenden Abgasgegendruck aus der Abgasstrecke.
aa) Die Klägerin bezieht sich auf die Nichteinhaltung der Vorgabe für Leistungswerte der Motoren im Leistungsverzeichnis in Abschnitt E 1, Ziffer 1.1.1 (Seite 1-1-3: „zulässiger Abgasgegendruck max. 50 mbar“, das entspricht 500 mmWS, vgl. GA Bd. I Bl. 70). Der Senat folgt ihr darin, dass es sich insoweit nach dem eindeutigen Wortlaut der Leistungsbeschreibung um einen Grenzwert und nicht etwa nur um einen Richtwert handelte. Sie behauptet u.a. unter Bezugnahme auf insgesamt 26 Inspektionsberichte der Fa. D., beginnend vom 02.12.1999 (ca. 680 mmWS, vgl. Anlage K 9, GA Bd. I Bl. 141) und vom 04.12.1999 (ca. 670 mmWS, vgl. Anlage K 10, GA Bd. I Bl. 142), weitere Berichte in der Zeit vom 11.05.2000 bis zum 16.01.2004 (Anlagenkonvolut K 73, GA Bd. VIII Bl. 72 ff.) auf einen durchschnittlichen Abgasgegendruck von 600 bis 700 mmWS. Ursache des zu hohen Abgasgegendrucks waren, wie inzwischen festzustellen, aber nicht näher auszuführen ist, insbesondere erhebliche konstruktive Querschnittsverengungen im Sekundärschalldämpfer. Mit diesem Mangel waren erhöhte Lärmemissionen und vor allem negative Rückwirkungen auf den Wirkungsgrad des Motors verbunden.
bb) Nur vorsorglich ist darauf zu verweisen, dass das Sachvorbringen der Klägerin zur haftungsausfüllenden Kausalität insoweit nicht schlüssig ist. Denn die Klägerin hat unter Berufung auf § 15 Abs. 3 Satz 3 ZVB die Zurückweisung der Abgasanlage erklärt (vgl. GA Bd. I Bl. 8); Rechtsfolge dieser Regelung wären jedoch ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) auf Demontage der Schalldämpferanlage ab Stutzen Abgasturbolader bis zur Einleitung in die Schornsteinanlage – und nur insoweit ggf. der Ersatz der Selbstvornahmekosten – sowie ein Anspruch auf Rückzahlung der hierauf entfallenden, bereits geleisteten Vergütung, nicht jedoch ein Anspruch auf Ersatz der Kosten der Neuherstellung.
b) Die Klägerin beruft sich andererseits auf den Austritt von Feuchtigkeit an der gesamten Abgasstrecke (Tropfenbildungen, Ablagerungen an Isolierungen und am Boden, zunehmend Korrosionserscheinungen). In der Folge traten Rissbildungen an den Bauteilen, insbesondere an den Abgaswärmetauschern, auf. Auf die realen Kosten des Austausches von drei Abgaswärmetauschern aufgrund von Korrosionserscheinungen bezieht sich auch die Klageerweiterung vom 20.07.2004 in Höhe von 107.139,65 Euro.
c) Selbst wenn der Senat zugunsten der Klägerin unterstellte, dass jeweils ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen dieser Sachmängel dem Grunde nach gegeben wäre, wären diese Ansprüche verjährt. Die Beklagte zu 1) hat die Einrede der Verjährung er hoben und diese Einrede ist begründet.
1. Die Dauer der Gewährleistung wurde im Bauvertrag individuell vereinbart und betrug drei Jahre. Diese Frist gilt für sämtliche streitgegenständlichen Gewährleistungsansprüche.
a) Die Parteien des Bauvertrages vom 10.04./07.05.1997 vereinbarten in § 17 ZVB eine Gewährleistungsfrist mit einer Dauer von 36 Monaten. Die hierfür in Ziffer 8 des Protokolls des Vergabegespräches vom 07.05.1997 vorgesehene Bedingung, der Abschluss eines Wartungsvertrages für die Dauer der Gewährleistung, war eingetreten.
b) Die nach der Struktur des Vertrages ohnehin nur subsidiär eingreifende VOB/B 1996 enthielt keine abweichenden Regelungen, denn in § 13 Nr. 4 VOB/B 1996 waren Regelungen zu Verjährungsfristen nur für den Fall aufgestellt, dass individuell keine Verjährungsfristen vereinbart wurden. Von der individuell vereinbarten Verjährungsfrist von drei Jahren gehen auch die Prozessparteien übereinstimmend aus.
c) Entgegen der Auffassung der Klägerin gilt keine abweichende Gewährleistungsfrist für die Mangelkomplexe „zu hoher Abgasgegendruck in der Abgasstrecke“ und „Schallproblematik in der Abgasstrecke“, welche sich jeweils auf Abweichungen der konkreten Ausführung der Sekundärschalldämpfer von anerkannten Regeln der Technik stützen.
aa) Zur Einordnung der Mängel ist auf Folgendes hinzuweisen: Der Abgasgegendruck entstand in der modulbezogenen Abgasstrecke (zweiter Teilbereich des BHKW) und wirkte auf die Motorenanlage (erster Teilbereich des BHKW) zurück. Bei einem höheren Abgasgegendruck muss der jeweilige Motor des Moduls eine höhere Leistung erbringen, um den gleichen elektrischen Wirkungsgrad zu erreichen (also ggf. umfangreicherer Energieträgereinsatz, höherer Verschleiß und wegen höherer Strömungsgeschwindigkeit des Rauchgases höhere Lärmemissionen). Als Ursache des behaupteten höheren Abgasgegendrucks und damit auch der höheren Lärmemissionen hat die Klägerin insbesondere konstruktive Mängel der Sekundärschalldämpfer benannt (Ausführung mit nur zwei Kulissen und einem kleinen Spalt zur Rauchgasdurchführung statt mit drei Kulissen und zwei Spalten mit der Folge der Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit der Abgase auf das Dreifache, keine Ausführung mit einem temperaturbeständigen Rieselschutz, keine Ausdehnbarkeit der Schalldämmkulissen). Daneben – und ohne einen Zusammenhang zur Schallproblematik – hat sie im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit des Anlagenteils den Einsatz eines minderwertigen Werkstoffs (Stahl 16Mo3 statt Edelstahl) zur Herstellung der Sekundärschalldämpfer gerügt.
bb) Allerdings geht die Klägerin zu Recht davon aus, dass neben der individuellen Vereinbarung über die Dauer der Verjährungsfrist auch die zur Zeit des Vertragsabschlusses gültige Vorschrift des § 638 Satz 1 Halbsatz 2 BGB a.F. („… sofern nicht der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat, …“) Anwendung findet. Der Vereinbarung in § 17 ZVB und auch dem Bauvertrag insgesamt kann der Wille, die festgelegte dreijährige Verjährungsfrist auch für den Fall des arglistigen Verschweigens eines Werkmangels vereinbaren zu wollen, nicht entnommen werden; ein dahingehender Wille hätte in der Verjährungsklausel ausdrücklich her vorgehoben werden müssen (vgl. nur BGH, Urteil v. 04.05.1970, VII ZR 134/68, WM 1970, 965). Wäre bezüglich eines Werkmangels dessen arglistiges Verschweigen durch die Beklagte zu 1) feststellbar, so führte dies zu einer längeren Verjährungsfrist – nach §§ 638 Satz 1, 195 BGB a.F. von dreißig Jahren ab Abnahme, nach Art. 229 § 6 Abs. 6 Satz 1 EGBGB von drei Jahren ab dem 01.01.2002.
cc) Hinsichtlich der vom gerichtlichen Sachverständigen festgestellten konstruktiven bzw. fertigungstechnischen Mängel der Sekundärschalldämpfer, welche in extremen Verengungen der Rauchgaswege bestanden (vgl. Gutachten Pe. v. 31.08.2009, S. 8 f., Sitzungsprotokoll v. 24.02.2011 – Anhörung Pe. -, S. 3, GA Bd. VIII Bl. 187), hat die Klägerin die Voraussetzungen für ein arglistiges Verschweigen nicht nachgewiesen.
(1) Insoweit fehlte es der Beklagten zu 1) bereits an einer Kenntnis des Mangels. Ein arglistiges Verschweigen eines Mangels setzt denknotwendig dessen Kenntnis voraus. Denn arglistig handelt nur derjenige, der bewusst einen (offenbarungspflichtigen) Mangel verschweigt. Ein Bewusstsein, die entsprechende Leistung vertragswidrig erbracht zu haben, fehlt, wenn der Mangel vom Auftragnehmer selbst nicht wahrgenommen wird (vgl. BGH, Urteil v. 11.10.2007, VII ZR 99/06, BGHZ 174, 32; vgl. auch Busche in: MüKo-BGB, Bd. 6, 8. Aufl. 2020, § 634a Rn. 38 m.w.N.). Die Klägerin hat eine Kenntnis der Beklagten zu 1) von der inneren Konstruktion der Sekundärschalldämpfer lediglich pauschal unter Verweis darauf behauptet, dass sie sich nicht vorstellen könne, dass eine Abweichung der Konstruktion von den mit deren Lieferung überreichten Plänen, wie vorliegend, aus Versehen zustande gekommen sei (vgl. Sitzungsprotokoll v. 02.08.2004, S. 4, GA Bd. III Bl. 208). Aus diesem Vorbringen ergibt sich in der vorliegenden Konstellation, in welcher die Beklagte zu 1) den Sekundärschalldämpfer nicht selbst fertigte, schon kein zwingender Rückschluss auf eine Verantwortlichkeit der Beklagten zu 1) für die Differenzen zwischen Plan und Wirklichkeit, erst recht aber kein Anhaltspunkt für eine Kenntnis der Beklagten zu 1) von dem unzureichenden Querschnitt der Rauchgaswege im Inneren des jeweiligen Sekundärschalldämpfers. Nach dem nicht erheblich bestrittenen Sachvortrag der Beklagten zu 1) wurden die Sekundärschalldämpfer extern von einem Dritten gefertigt und als Komplettbauteil an die Baustelle geliefert. Die Beklagte zu 1) ließ sie durch eine Nachauftragnehmerin lediglich montieren und in die Gesamtanlage einfügen. Der innere Aufbau der Sekundärschalldämpfer war bei Anlieferung nicht zu erkennen. Eine Öffnung der Sekundärschalldämpfer zur Durchführung einer Kontrolle war weder vorgesehen noch im Sinne eines Werkerfolgs zielführend, weil sie zur Beschädigung der Bauteile geführt hätte; das Gehäuse war außen umlaufend verschweißt (vgl. Anlage K 6, GA Bd. I Bl. 137). Wie die Klägerin selbst vorträgt, wich der innere Aufbau der Sekundärschalldämpfer von den mitgelieferten Plänen ab, so dass die Beklagte zu 1) auch aus den mitgelieferten Plänen nicht etwa auf einen zu geringen Strömungsquerschnitt hätte schließen können.
(2) Zwar können die Voraussetzungen für ein arglistiges Verschweigen auch bei einer Hilfsperson i.S.v. § 278 BGB vorliegen, so dass sich der Werkunternehmer dann so behandeln lassen muss, als hätte er selbst den Mangel verschwiegen. Das trifft vor allem dann zu, wenn sich der Unternehmer des Gehilfen gerade zur Erfüllung seiner Offenbarungspflicht gegenüber dem Vertragspartner bedient hat (vgl. BGH, Urteil v. 20.12.1973, VII ZR 184/72, BGHZ 62, 63; kritisch dazu Jurgeleit BauR 2018, 389). Dies gilt aber nicht für die – hier zu Gunsten der Klägerin unterstellte – Kenntnis des Herstellers und Lieferanten der Sekundärschalldämpfer von der Abweichung der tatsächlichen Ausführung der Konstruktion von den mitgelieferten Konstruktionsplänen. Denn dieser Lieferant war zwar Erfüllungshilfe der Beklagten zu 1) bei der Herstellung des Werkes, aber nicht sein Erfüllungsgehilfe in Bezug auf seine Offenbarungspflicht gegenüber der Klägerin (vgl. BGH, Urteil v. 08.05.1968, VIII ZR 62/66, MDR 1968, 660; BGH, Urteil v. 20.12.1973, VII ZR 184/72, BGHZ 62, 63; BGH, Urteil v. 11.10.2007, VII ZR 99/06, BGHZ 174, 32). Insoweit könnte eine Zurechnung zulasten der Beklagten zu 1) nur erfolgen, wenn sie die Lieferantin nicht sorgfältig ausgewählt hätte; für eine derartige Pflichtverletzung hat die Klägerin nichts vorgetragen. Folgte man alternativ dem Ansatz über eine Zurechnung der Kenntnis eines Wissensvertreters nach § 166 Abs. 1 BGB analog (so Jurgeleit a.a.O.), so stellte sich der Lieferant gerade nicht als Repräsentant der Beklagten zu 1) gegenüber der Klägerin dar. Denn nach der Arbeitsorganisation der Beklagten zu 1) sollte nicht etwa der Lieferant, sondern ihr eigener örtlicher Bauleiter L. als Ansprechpartner der Klägerin für die mangelfreie Erstellung der Schalldämpferanlage agieren, die ihm dabei angefallenen Informationen zur Kenntnis nehmen und ggf. weiterleiten.
(3) Schließlich verweist die Klägerin zwar zu Recht darauf, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Organisationsverschulden einem arglistigen Verschweigen von Mängeln gleichstehen kann; diese Voraussetzungen sind hier jedoch nicht erfüllt. Der Werkunternehmer, der ein Bauwerk arbeitsteilig herstellen lässt, muss die organisatorischen Voraussetzungen schaffen, um sachgerecht beurteilen zu können, ob das Bauwerk bei Ablieferung mangelfrei ist. Das bedeutet, dass er für eine den Umständen nach angemessene Überwachung und Prüfung der Leistung und damit dafür sorgen muss, dass er oder seine insoweit eingesetzten Erfüllungsgehilfen zur Offenbarung etwaige Mängel erkennen können. Unterlässt er dies, so verjähren Gewährleistungsansprüche des Bestellers – wie bei arglistigem Verschweigen des Mangels – nach alter Rechtslage erst nach dreißig Jahren, wenn der Mangel bei richtiger Organisation entdeckt worden wäre (vgl. BGH, Urteil v. 20.12.1973, VII ZR 184/72, BGHZ 62, 63; BGH, Urteil v. 15.01.1976, VII ZR 96/74, BGHZ 66, 43; BGH Urteil v. 12.03.1992, VII ZR 5/91, BGHZ 117, 318). Dieser Rechtsprechung liegt der Gedanke zugrunde, dass eine mangelhafte Organisation gerade nicht dazu führen darf, die Arglisthaftung zu vermeiden (vgl. BGH, Urteil v. 27.11.2008, VII ZR 206/06, BGHZ 179, 55; auch Busche, a.a.O., § 434a Rn. 41). Ein solches Organisationsverschulden der Be klagten zu 1) ist nicht nachgewiesen. Die Beklagte zu 1) hat einen örtlichen Bauleiter, Herrn L., eingesetzt, welcher die mitgelieferten Pläne der Sekundärschalldämpfer auch prüfte und freigab sowie an die von der Klägerin mit der Bauüberwachung betraute Beklagte zu 2) bzw. die in deren Auftrag tätige Streithelferin weiterleitete.
dd) Ein arglistiges Verschweigen der Beklagten zu 1) ist hinsichtlich des Einsatzes eines unzureichenden Werkstoffes für die Fertigung der Sekundärschalldämpfer hat das Landgericht ebenfalls nicht festzustellen vermocht; dies begegnet keinen Zweifeln des Senats.
(1) Allerdings hat der gerichtliche Sachverständige, insoweit den Feststellungen der B. (B.) im Schiedsgutachten und des T. im Gutachten vom 13.03.2003 (Anlage K 4, GA Bd. I Bl. 91), dort S. 4, folgend, festgestellt, dass die für die Herstellung der Sekundärschalldämpfer eingesetzte ferristische Stahllegierung 16Mo3 von der Vorgabe des Leistungsverzeichnisses („Edelstahl“, vgl. LV Abschnitt E, S. 1- 1-8, GA Bd. I Bl. 75) abwich. Dies wird letztlich von der Beklagten zu 1) nicht mehr in Abrede gestellt. Der gerichtliche Sachverständige Pe. hat darüber hinaus ausgeführt, dass dieser Werkstoff, anders als die Beklagte zu 1) behauptet hat, für Temperaturen von 550°C ungeeignet war (vgl. Gutachten v. 31.08.2009, S. 7) und hierin ein Mangel mit erheblichen Auswirkungen auf die Lebensdauer des BHKW liegt.
(2) Die Klägerin hat jedoch den Vortrag der Beklagten zu 1) nicht widerlegt, dass ihr hierfür verantwortlicher Bauleiter L. den Einsatz dieses Werkstoffs für tauglich erachtete und die Informationen an die – letztlich im Auftrag der Klägerin mit der Prüfung betraute – Streithelferin der Beklagten zu 2) weiterleitete. Das zeigt sich schon in dem Eingeständnis der Klägerin, dass sie letztlich nicht wissen könne, ob die Beklagte zu 1) gegenüber der Beklagten zu 2) (bzw. deren Streithelferin) oder ob die Beklagte zu 2) ihr gegenüber diesen für sie maßgeblichen Umstand verschwiegen habe (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 06.05.2004, S. 8, GA Bd. III Bl. 1 ff., 8).
Die Klägerin geht zutreffend davon aus, dass grundsätzlich ihr die Darlegungs- und Beweislast dafür obliegt, dass die Beklagte zu 1) ihrer Offenbarungspflicht nicht genügt hat. Da es sich bei der unterbliebenen Offenbarung um eine negative Tatsache handelt, hat es der Beklagten zu 1) nach den Grundsätzen der sekundären Darlegungslast oblegen, konkrete Anhaltspunkte für die Weiterleitung der Information vorzutragen (vgl. BGH, Urteil v. 12.11.2010, V ZR 181/09, BGHZ 188, 43). Diese Obliegenheit hat die Beklagte zu 1) erfüllt. Sie hat angegeben, dass sie in der Bauberatung vom 14.08.1997 von der Streithelferin der Beklagten zu 2) zur Übergabe der „Schalldämpferzeichnung“ bis zum 28.08.1997 aufgefordert worden sei (vgl. Protokoll v. 19.08.1997, dort zu Ziffer 3) „Schalldämpfer“, Anlage K 29, GA Bd. III Bl. 56 ff.), dass sie mit Schreiben vom 22.08.1997 eine Zwischennachricht erteilt habe (vgl. Anlage B 2, GA Bd. II Bl. 36 ff.) und dass sie mit Telefax vom 25.08.1997 (Anlage B 3, GA Bd. III Bl. 38 f.) die Zeichnung übersandt habe. Dem vorgelegten Telefax ist dabei zwar zu entnehmen, dass die Zeichnung nicht vollständig übermittelt wurde, aber jedenfalls derjenige Ausschnitt, aus welchem der für das Gehäuse eingesetzte Werkstoff eindeutig hervorgeht. Der Senat folgt auch der Feststellung des Landgerichts, dass der Klägerin bzw. der für sie empfangsberechtigten Streithelferin der Beklagten zu 2) die vollständige Konstruktionszeichnung nachträglich zugegangen ist. Denn in den nachfolgenden Baubesprechungen, in denen jeweils die offenen Punkte fortgeschrieben wurden, verlangte die Streithelferin der Beklagten zu 2) jedenfalls die Konstruktionszeichnungen der Schalldämpfer nicht mehr, was den Schluss auf ihren Zugang bei ihr zulässt. Schließlich spricht für diesen Umstand, dass im Rechtsstreit die Anlage K 6 (vollständig) von der Klägerin vorgelegt worden ist, was voraussetzt, dass diese Zeichnungen ihr zugegangen sind.
Der Beweiswürdigung des Landgerichts steht nicht entgegen, dass die schriftliche Freigabeerklärung des Bauleiters der Beklagten zu 1) auf der Konstruktionszeichnung der Lieferantin und dessen Schreiben an die Streithelferin der Beklagten zu 2) dasselbe Datum (22.08.1997) tragen. Das Datum sagt nichts über die Reihenfolge der Bearbeitung am selben Tage aus. Es ist nicht auszuschließen, dass der Bauleiter L. zunächst das Schreiben an die Streithelferin verfasste und im weiteren Verlaufe des Tages die Konstruktionszeichnungen vorgelegt bekam, prüfte und freigab. Soweit die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 15.07.2022 darin ein Beweisanzeichen für ein Beschwichtigen oder Hinhalten gesehen hat, bewertet der Senat das Schreiben, insoweit dem Landgericht folgend, als eine sachliche Zwischenantwort. Es ist auch darauf zu verweisen, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Offenbarung der Zeitpunkt der Abnahme ist, hier also der 30.12.1997. Zu diesem Zeitpunkt lag der Klägerin die Information über den eingesetzten Werkstoff bereits mehrere Monate zur Prüfung vor.
2. Die Verjährungsfrist von drei Jahren begann einheitlich für das gesamte BHKW am 23.12.1997. Der Senat folgt der vom Landgericht getroffenen Feststellung, dass die Vertragsparteien mit ihrer Vereinbarung vom 23.12.1997 (Anlage B 23, GA Bd. IV Bl. 217 f.) den Beginn der Verjährungsfrist eindeutig, klar und einheitlich neu regelten.
a) Nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO hat das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten Tatsachen zugrunde zu legen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten. Im Berufungsverfahren findet danach grundsätzlich keine Wiederholung der Tatsachenfeststellung statt, sondern lediglich eine Fehlerkontrolle und -beseitigung (vgl. nur Heßler in: Zöller, ZPO, 34. Aufl. 2022, § 529 Rn. 1 m.w.N.). Dabei ist das Berufungsgericht nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht an die vertretbare Auslegung einer Individualvereinbarung durch das erstinstanzliche Gericht gebunden, sondern hat auf der Grundlage der nach § 529 ZPO maßgeblichen Tatsachen eine eigene Auslegung vorzunehmen (vgl. BGH, Urteil v. 14.07.2004, VIII ZR 164/03, BGHZ 160, 83).
b) Im vorliegenden Fall hatten die Vertragsparteien ursprünglich in § 17 ZVB den Beginn der Gewährleistungsfrist an den Zeitpunkt der Abnahme geknüpft und in § 14 Abs. 1 VOB/B zwingend eine förmliche Abnahme der Leistungen vereinbart. In § 15 Abs. 3 Satz 2 ZVB war ein abweichender Beginn der Gewährleistungsfrist für nachgebesserte Anlagenteile vorgesehen. Am 23.12.1997 vereinbarten die Vertragsparteien in dem „Übergabeprotokoll zum Gefahrenübergang während des Probebetriebes“, dass ein befristeter Gefahrenübergang in der Zeit vom 23.12.1997, 16:00 Uhr, bis zum 29.12.1997, 0:00 Uhr, erfolgen solle, nachdem die Funktionsprüfung aller Anlagenteile stattgefunden habe. Sodann hieß es in der Vereinbarung: „Die Gewährleistung beginnt für die BHKW-Anlagen am 23.12.1997.“ Zugleich wurde festgelegt, dass die Abnahme der Gesamtanlage am 30.12.1997, 12:00 Uhr, stattfinden solle (vgl. Anlage B 23, GA Bd. IV Bl. 217 f.).
c) Die Vereinbarung vom 23.12.1997 bedarf der Auslegung nach den Grundsätzen der §§ 133, 157 BGB. Im Ergebnis der Auslegung ist festzustellen, dass die Vertragsparteien sich mit dieser Vereinbarung bewusst und eindeutig von den bisher getroffenen Regelungen distanzierten und eine neue, einfacher zu handhabende Regelung schufen.
aa) Zunächst ist darauf zu verweisen, dass das Landgericht zu Recht davon ausgegangen ist, dass es rechtlich zulässig ist, nachträglich durch Individualvereinbarung eine Abkürzung der Gewährleistungsfrist vorzunehmen (BGH, Urteil v. 23.01.2002, X ZR 184/99, NJW-RR 2002, 664 – dort aber nicht festzustellen; OLG Braunschweig, Urteil v. 20.12.2012, 8 U 7/12, BauR 2013, 970; OLG Düsseldorf, Urteil v. 09.02.2016, I-21 U 183/15, BauR 2017, 1681). Dem steht schon allgemein nicht entgegen, dass die Parteien zuvor eine differenziertere Regelung über Teilabnahmen und sukzessive laufende Gewährleistungsfristen getroffen haben. Das gilt auch für den vorliegenden Fall.
bb) Mit der am 23.12.1997 getroffenen Vereinbarung regelten die Parteien ausdrücklich die Frage des Beginns der Gewährleistungsfrist. Der in der Regelung genannte Termin sollte unabhängig davon, dass die förmliche Abnahme der Gesamtanlage erst an einem späteren, in derselben Vereinbarung genannten Termin stattfinden sollte, und unabhängig davon, ob bei dieser zeitlich nachfolgenden Abnahme Mängel der Vertragsleistungen festgestellt wurden, den Lauf der Gewährleistungsfrist in Gang setzen. Für den Beginn der Verjährungsfrist sollte nunmehr ein nach dem Kalender vereinbarter Termin und nicht etwa ein Ereignis, wie die Gesamtabnahme, maßgeblich sein. Der Wortlaut der Vereinbarung ist insoweit eindeutig und klar. Zur wechselseitigen Interessenlage der Vertragsparteien haben diese nicht vorgetragen und das Landgericht keine Feststellungen getroffen, so dass dieser Umstand offenbleiben muss. Es mag sein, dass für die Klägerin im Hinblick auf die Höhe der Einspeisevergütung eine Inbetriebnahme des BHKW vor dem 31.12.1997 wirtschaftlich von Interesse war und nicht durch den relativ späten Abnahmetermin am 30.12.1997 gefährdet werden sollte, was sie durch die Vereinbarung eines sofortigen und einheitlichen Beginns der Gewährleistungsfrist zugunsten der Beklagten zu 1) sicherstellte. Letztlich kommt es auf etwaige interne Vorbehalte der Klägerin nicht an, denn im Rechtsverkehr muss sie sich am objektiven Erklärungsgehalt ihrer Willenserklärungen festhalten lassen. Der Wirksamkeit der Vereinbarung steht auch nicht entgegen, dass später nicht nur eine Gesamtabnahme, sondern zeitlich gestreckt weitere Teilabnahmen nach dem vereinbarten Stichtag stattfanden, weil die Vereinbarung sachlich alle von der Klägerin im Rahmen des Bauvertrages erbrachten Leistungen umfasste (vgl. KG Berlin, Urteil v. 11.03.2011, 6 U 128/08, nachgehend BGH, Beschluss v. 22.12.2011, VII ZR 85/11). Während bei einem Abstellen auf die Abnahme als den Lauf der Gewährleistung auslösendes Ereignis eine differenzierte Folgeregelung der Anknüpfung des Laufs der Gewährleistung an Einzelabnahmen bei nach gebesserten Anlagenteilen nachvollziehbar ist, ist für eine solche Folgeregelung kein Raum mehr, wenn die Vertragsparteien bewusst auf eine Differenzierung zwischen der Abnahme originärer und der Abnahme von Nachbesserungsleistungen verzichten und den Beginn des Fristlaufs an einen nach dem Kalender bestimmten Zeitpunkt knüpfen.
cc) Entgegen dem Berufungsvorbringen der Klägerin lässt das Nachverhalten der Vertragsparteien nicht etwa den Schluss darauf zu, dass sie an der ursprünglichen, im Bauvertrag enthaltenen Regelung zum Beginn der Verjährungsfrist festhalten wollten, und zwar auch ungeachtet des Umstandes, dass der Wortlaut der Vereinbarung vom 23.12.1997 nicht in diesem Sinne umgedeutet werden kann. Die Parteien nahmen mit der Vereinbarung vom 23.12.1997 weder von der Verabredung einer förmlichen Gesamtabnahme Abstand, wie an der Aufführung des Termins zu sehen ist, noch von der Absicht, eine Mängel- und Restpunkteliste zu erstellen und während der Gewährleistungszeit fortzuführen. Sie veränderten lediglich den zeitlichen Anknüpfungspunkt für den Lauf der Gewährleistungsfrist. Bezogen auf die Gewährleistungsfrist gibt es keine abweichenden Äußerungen oder Handlungen der Vertragsparteien bis zu der Erklärung der Beklagten zu 1) vom 20.03.2003 (Anlage K 26, GA Bd. III Bl. 52). Soweit die Klägerin darauf verwiesen hat, dass im Abnahmeprotokoll vom 30.12.1997 (Anlage B 1, GA Bd. II Bl. 29) auf § 14 ZVB Bezug genommen wurde, hat das Landgericht zutreffend festgestellt, dass die Bezugnahme lediglich zur Klarstellung des dort definierten Begriffs der förmlichen Abnahme erfolgte. Auch die weitere Korrespondenz der Vertragsparteien im Dezember 1997 bezog sich nicht auf die Berechnung der Gewährleistungsfrist. Das Schreiben der Klägerin an die Beklagte zu 1) vom 10.12.1998 (Anlage K 12, GA Bd. I Bl. 146), mit welchem die Klägerin ein Angebot der Beklagten zu 1) vom 08.12.1998 (Anlage K 13, GA Bd. I Bl. 147 f.) zur Beseitigung des Mangels „Überschreitung des maximalen Schallleistungspegels“ annahm, schloss zwar mit dem Verlangen, dass die Gewährleistung für diese Maßnahme nach endgültiger Abnahme beginnen sollte. Hierauf ließ sich die Beklagte zu 1) jedoch nicht ein, wie ihrem Schreiben vom 14.12.1998 (Anlage B 3 IV, GA Bd. IX Bl. 134 f.) zu entnehmen ist. Selbst wenn die Parteien jedoch bezüglich dieser Auftragserweiterung – Einbau eines ursprünglich nicht vorgesehenen Mündungsschalldämpfers am Schornsteinkopf – eine gesondert laufende Gewährleistungsfrist vereinbart hätten, stellte das die Wirksamkeit der Vereinbarung vom 23.12.1997 für den Beginn der Gewährleistung für sämtliche Vertragsleistungen nicht in Frage. Ohne Erfolg bleibt auch der mehrfache Verweis der Klägerin auf die Abnahme verlangen der Beklagten zu 1), zuletzt in ihrem Schriftsatz vom 15.07.2022. Die Vereinbarung einer einheitlichen und ab dem 23.12.1997 beginnenden Gewährleistung machte, wie voraus geführt, die Abnahme der Leistungen der Beklagten zu 1) nicht entbehrlich, sondern nahm der Abnahme lediglich die Funktion des In-Gang-Setzens der Gewährleistungsfrist. Insbesondere setzte im Hinblick auf die von den Vertragsparteien geführte Mängel- und Restpunkteliste die Erledigung von Mangelbeseitigungsverlangen der Klägerin durch die Beklagte zu 1) zumindest eine Fertigstellungsanzeige der Auftragnehmerin voraus.
3. Begann nach den Vorausführungen die Gewährleistungsfrist von drei Jahren am 23.12.1997, so endete sie nach § 188 Abs. 2 BGB in der hier nach Art. 229 § 6 Abs. 5, Abs. 1 Satz 1 EGBGB in der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung (künftig: BGB a.F.) am 22.12.2000.
4. Hinsichtlich beider Mangelkomplexe hat der Lauf der dreijährigen Verjährungsfrist jeweils mit dem Zugang der hierauf gerichteten Mangelanzeige erneut zu laufen begonnen.
a) Die Vertragsparteien haben nach den Vorausführungen die (subsidiäre) Geltung der Regelungen der VOB/B 1996 wirksam vereinbart. Nach § 13 Nr. 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B 1996 beginnt die vereinbarte Regelfrist für die Verjährung eines Anspruchs auf Beseitigung von Mängeln, welche erst nach der Abnahme zutage treten (vgl. Wirth, a.a.O., § 13 Abs. 5 Rn. 37 m.w.N.), am Tage des Zugangs des schriftlichen Verlangens der Mangelbeseitigung.
b) Sowohl die Überschreitung des maximal zulässigen Abgasgegendrucks an allen fünf Modulen als auch den Austritt von Feuchtigkeit an der Abgasstrecke zeigte die Klägerin gegen über der Beklagten zu 1) mit ihrem Schreiben vom 11.05.1999 (Anlage K 28, GA Bd. III Bl. 54 f.) an und forderte sie auf, die Abstellung dieser Mängel kurzfristig zu veranlassen. Das Schreiben ging der Beklagten zu 1) per Telefax am selben Tage zu. Dieses Verlangen erfasste sämtliche von der Klägerin im Verlaufe der vorgerichtlichen und gerichtlichen Auseinandersetzung in diesem Zusammenhang stehenden Mangelursachen, auch die erstmals mit Schreiben vom 12.03.2003 gerügten konkreten Mängel an den Sekundärschalldämpfern (Konstruktionsabweichungen und unzureichender Werkstoff). Denn nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist der Mangel vom Auftraggeber nach seinem äußeren objektiven Erscheinungsbild zu beschreiben; die hierdurch ausgelöste Nacherfüllungspflicht des Auftragnehmers bezieht sich „automatisch“ auf sämtliche Mangelursachen, durch die der jeweils beschriebene Mangel verursacht wurde (vgl. nur Wirth, a.a.O., § 13 Abs. 5 Rn. 47 m.w.N.). Die schriftliche Aufforderung zur Mangelbeseitigung kann je Mangel auch nur einmal die Verjährung verlängern, auf weitere Aufforderungen kommt es für den Lauf der Frist nicht an.
c) Damit begann die Verjährungsfrist der Mangelbeseitigungsansprüche, welche der Schadensposition Neuerrichtung der Abgasstrecke zugrunde liegen, jeweils am 11.05.1999 und endete am 10.05.2002.
5. Weitere Hemmungen bzw. Unterbrechungen der Verjährungsfrist sind nicht wirksam geworden.
a) Eine Hemmung der Verjährung im Hinblick auf die Prüfung von Mangelanzeigen, die Durchführung von Verhandlungen oder von Nachbesserungsarbeiten kommt nach den Regelungen des Bauvertrags nicht in Betracht.
aa) Auf hemmungsauslösende Ereignisse bis zum 31.12.2001 sind nach Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB die gesetzlichen Vorschriften des BGB in der bis zum 31.12.2001 einschließlich geltenden Fassung (BGB a.F.) anzuwenden. Deswegen kommt ein Rückgriff auf den mit der Schuldrechtsreform neu geschaffenen allgemeinen Hemmungstatbestand des § 203 BGB n.F. entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht in Betracht.
bb) Allerdings sah § 639 Abs. 2 BGB a.F. vor, dass eine Hemmung der Verjährung von werkvertraglichen Mangelbeseitigungsansprüchen auch für die Dauer der einvernehmlichen Prüfung der Vertragsparteien, ob ein Mangel vorliegt, sowie für die Dauer der Nachbesserungsarbeiten eintritt; diese Regelung galt grundsätzlich auch für VOB-Bauverträge (vgl. Sprau in: Palandt, BGB, 61. Aufl. 2002, § 639 Rn. 7 m.w.N.). Die Vertragsparteien haben diese Regelung jedoch abbedungen. Denn sie vereinbarten, dass die Gewährleistungsfrist von drei Jahren nur dann Wirksamkeit entfalten sollte, wenn parallel ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, mit welchem der Beklagten zu 1) sämtliche Wartungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten exklusiv übertragen wurden. Damit entzogen die Vertragsparteien die Frage dem Streit, wer bei auftretenden Problemen an dem BHKW tätig werden sollte, und verlagerten etwaige Auseinandersetzungen, wie der Rechtsstreit zeigt, auf die Frage, ob und inwiefern für Arbeiten der Beklagten zu 1) eine Vergütung zu zahlen war. Für die gesamte Laufzeit des Wartungsvertrages bedurfte es keiner weiteren Einigung über die Prüfung des Mangels durch die Beklagte zu 1); hierzu verpflichtete sie sich im Wartungsvertrag. Es liefe der gleichzeitig und nur unter der Bedingung des Abschlusses des Wartungsvertrages für die gesamte Gewährleistungsfrist geschlossenen Vereinbarung zuwider, wenn der Lauf der Verjährung während der Laufzeit des Wartungsvertrages vollständig gehemmt wäre. b) Das Landgericht hat zutreffend festgestellt, dass die Beklagte zu 1) gegenüber der Klägerin keine Erklärung abgab, welche als ein Anerkenntnis i.S.v. § 208 BGB a.F. zu bewerten wäre. Insbesondere beinhaltete das Schreiben der Beklagten zu 1) vom 10.03.2000 entgegen der Auffassung der Klägerin in ihrer Berufungsbegründung kein solches Anerkenntnis.
aa) Ein Anerkenntnis i.S.v. § 208 BGB a.F. ist eine geschäftsähnliche Handlung, aus dem sich das Bewusstsein vom Bestehen des Anspruchs, hier des Anspruchs auf Mangelbeseitigung an der Abgasstrecke, ergibt. Es muss klar abzugrenzen sein von einer Handlung aus Kulanz oder einer Maßnahme zur gütlichen Einigung.
bb) Mit ihrem Schreiben vom 10.03.2000 (Anlage K 25, GA Bd. III Bl. 51) nahm die Beklagte zu 1) Bezug auf eine vorherige telefonische Absprache und bestätigte den ihr vorgeschlagenen Termin am 28.03.2000 „als Abnahmetermin / Restpunkte“. Allein in einer Terminbestätigung liegt jedoch kein Handeln, aus dem sich sicher auf ein Anerkenntnis des Anspruchs der Klägerin auf Mangelbeseitigung schließen lässt, sondern im Zweifel ein rein organisatorischer Akt. Dies gilt umso mehr, als die Parteien des Bauvertrags über den Wartungsvertrag weiter miteinander verbunden geblieben waren. Darüber hinaus bezieht sich dieses Schreiben nicht auf die Beseitigung der am 11.05.1999 erstmals angezeigten Mängel. Bei dem verabredeten und dann nicht durchgeführten Abnahmetermin am 28.03.2000 ging es ausschließlich um Mängel der Bauleistung, welche bereits bei der Abnahme bekannt waren und deren Beseitigung deswegen vorbehalten wurde, bzw. um Restleistungen aus dem Bauvertrag; hierüber hatten die Vertragsparteien eine Restepunkteliste zum Übergabeprotokoll vom 30.12.1997 gefertigt und sukzessive fortgeschrieben. Die Restepunkteliste (in: Anlage B 1, GA Bd. II Bl. 30) führte, soweit in diesem Zusammenhang interessierend, unter Ziffer 5 „Sonstige Restpunkte“ lediglich auf: „5.1 Beseitigung zu hoher Schallemissionen gemäß noch ausstehender Messungen – Termin nach Messung“. Mit diesem Restpunkt war die Beseitigung der Überschreitung des maximalen Schallemissionspegels lt. Leistungsverzeichnis am Ausgang der Schornsteinanlage gemeint. Insoweit wurde, wie vorausgeführt, der Mangel bereits im Jahre 1999 endgültig beseitigt.
c) Das Landgericht hat zu Recht angenommen, dass die durch die Einleitung des selbständigen Beweisverfahrens nach § 485 Abs. 2 ZPO i.V.m. §§ 639 Abs. 1, 477 Abs. 2 Satz 1, 209 Abs. 2 BGB a.F. grundsätzlich bewirkte Unterbrechung der Verjährung (vgl. Heinrichs in: Palandt, BGB, 61. Aufl. 2002, § 209 Rn. 23 m.w.N.) nach §§ 639 Abs. 1, 477 Abs. 2 Satz 2, 212 Abs. 1 BGB a.F. als nicht erfolgt gilt, wenn der Antrag auf Durchführung des Beweisverfahrens zurückgenommen wurde. So liegt der Fall hier: Die Klägerin leitete zwar am 29.12.2000 ein selbständiges Beweisverfahren ein, sie nahm aber ihren Antrag am 16.10.2002 zurück. Gegen diesen Aspekt der erstinstanzlichen Entscheidungsgründe hat die Klägerin mit ihrer Berufung auch keine gesonderten Einwendungen erhoben. d) Weitere verjährungshemmende bzw. -unterbrechende Ereignisse lagen bis zum Ablauf der Verjährungsfrist am 10.05.2002 nicht vor. Die Vereinbarungen in dem Schiedsgutachtenvertrag vom 06./28./30.08.2002 wurden nach dem Ablauf der Verjährungsfrist getroffen. Die einseitige Verzichtserklärung der Beklagten zu 1) vom 20.03.2003 bezog sich unmissverständlich nur auf noch nicht verjährte Ansprüche.
Zum Komplex I B:
Die Klägerin kann auch gegen die Beklagte zu 2) keinen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung im Zusammenhang mit der Beauftragung mit der Bauüberwachung und der Objektüberwachung innerhalb der Gewährleistungsfrist durchsetzen.
I. Das Landgericht hat zu Recht darauf erkannt, dass etwaige Haftungsansprüche der Klägerin gegen die Beklagte zu 2) wegen Mängeln der Bauüberwachung (LPh 8) mit Ausnahme der Mängel, die Gegenstand des Schiedsgutachtervertrages waren, nicht mehr mit Erfolg gerichtlich geltend gemacht werden können, weil sie verjährt sind.
1. Die Klägerin und die Beklagte zu 2) haben im Ingenieurvertrag 12.12.1996 eine Verjährungsfrist von fünf Jahren vereinbart (§ 11 Abs. 5, vgl. Anlage K 1, GA Bd. I Bl. 19, 22 Rs.).
2. Das Landgericht hat die Vereinbarung in § 11 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 des Ingenieurvertrages zutreffend dahin ausgelegt, dass die Verjährung für die im Rahmen der Leistungsphase 8 zu erbringenden Bauüberwachungsleistungen mit der Übernahme der baulichen Anlage durch die Klägerin beginnen sollte. Das war hier der 23.12.1997, so dass die Verjährung am 22.12.2002 endete.
3. Innerhalb dieser Verjährungsfrist trat eine verjährungshemmende oder -unterbrechende Wirkung – mit Ausnahme durch den Abschluss des Schiedsgutachtervertrages am 06./28./30.08.2002 – nicht ein. Insbesondere gilt auch insoweit, dass die verjährungsunterbrechende Wirkung der Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens, welches auch gegen die hiesige Beklagte zu 2) gerichtet gewesen ist, rückwirkend entfiel, weil die hiesige Klägerin ihren Antrag am 16.10.2002 zurückgenommen hat.
4. Die von den Vorausführungen ausgenommenen Gewährleistungsansprüche der Klägerin gegen die Beklagte zu 2) wegen möglicher Bauüberwachungsfehler sind nicht verjährt.
Unter Ziffer III des o.g. Schiedsgutachtervertrages vereinbarten die Parteien, darunter die Klägerin und die Beklagte zu 2), dass die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, die sich auf Mängel beziehen, welche Gegenstand der Schiedsgutachtervereinbarung sind, mit Abschluss der Vereinbarung gehemmt sei, sowie, dass die Hemmung drei Monate nach der Beendigung des Schiedsgutachterverfahrens enden solle.
a) Die durch diese Vereinbarung bewirkte Hemmung der Verjährung beschränkt sich auf etwaige Bauüberwachungsfehler der Beklagten zu 2) im Hinblick auf zwei Mangelkomplexe. Gegenstand der Schiedsgutachtervereinbarung waren Mängel an den Abgaswärmetauschern – und zwar sowohl hinsichtlich der Feuchtigkeitsproblematik einschließlich der Korrosion von Bauteilen als auch hinsichtlich der Verursachung eines überhöhten Abgasgegendrucks – und an der Schornsteinanlage – hier allein im Hinblick auf die Feuchtigkeitsproblematik.
b) Nach dem Wortlaut der Vereinbarung trat die Hemmungswirkung am 30.08.2002 und mithin 114 Kalendertage vor dem Ablauf der Verjährungsfrist am 22.12.2002 ein.
c) Die Hemmungswirkung endete am 09.10.2004. Denn das Schiedsgutachterverfahren endete damit, dass die Klägerin am 09.07.2004 die Leistungen des Schiedsgutachters beanstandete und keine weiteren Ergänzungsfragen mehr stellte.
d) Nach dem 09.10.2004 lief die restliche Gewährleistungsfrist weiter und wäre am 31.01.2005 abgelaufen. Der Lauf dieser Frist wurde durch die auf den Zeitpunkt der Klageeinreichung am 30.12.2003 zurückwirkende Klageerhebung gegen die Beklagte zu 2) in Höhe des geltend gemachten Zahlungsanspruchs von 998.391,23 Euro nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB n.F. gehemmt. Gleiches gilt für die Klageerweiterung vom 20.07.2004 in Höhe des zusätzlich geltend gemachten Zahlungsanspruchs von 107.139,65 Euro. Hierüber streiten die Prozessparteien nicht.
II. Hinsichtlich der nicht verjährten Gewährleistungsansprüche der Klägerin gegen die Beklagte zu 2) im Zusammenhang mit deren vertraglichen Verpflichtungen zur Bauüberwachung bis zum 23.12.1997 hat die Klägerin eine schuldhafte Pflichtverletzung der Beklagten zu 2) nicht nachgewiesen.
1. Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Vereinbarung der Parteien zur Verbindlichkeit des Schiedsgutachtens in Ziffer VIII des Vertrages Auswirkungen auf den vor liegenden Rechtsstreit hat, weil sie ein sog. Prozessvertrag ist (vgl. Geimer in: Zöller, ZPO, 34. Aufl. 2022, § 1029 Rn. 15).
a) Die Parteien vereinbarten, dass die Entscheidung des Schiedsgutachters endgültig und verbindlich sein sollte. Gegenstand der Entscheidung des Schiedsgutachters sollten nach Ziffer II des Vertrages jedoch allein technische Fragen zu Mangelerscheinungen und Mangelursachen sein. Inhalt eines Schiedsgutachtervertrages kann es sein, für ein Rechtsverhältnis erhebliche Tatsachen durch einen Sachverständigen ermitteln und feststellen zu lassen (vgl. BGH, Urteil v. 09.06.1983, IX ZR 41/82, BGHZ 87, 367).
b) Eine Überprüfung des Schiedsgutachtens sollte nur dann stattfinden, wenn es grob unbillig und deswegen i.S.v. §§ 412, 493 ZPO unbrauchbar sei. Danach sollte das Ergebnis der Feststellungen des Schiedsgutachters für die Vertragspartner nur dann unverbindlich sein, wenn es offenbar unrichtig ist. Nicht jeder Fehler führt zur offenbaren Unrichtigkeit. Er muss sich vielmehr einem sachkundigen und unbefangenen Beobachter – wenn auch möglicherweise erst nach eingehender Prüfung – aufdrängen; dabei sind an das Vorliegen einer offenbaren Unrichtigkeit strenge Anforderungen zu stellen, weil anderenfalls der mit der Bestellung des Schiedsgutachters verfolgte Zweck in Frage gestellt würde (vgl. BGH, Urteil v. 09.06.1983, IX ZR 41/82, BGHZ 87, 367). Mit anderen Worten: Der Zugang zu staatlichen Gerichten war hierdurch nicht ausgeschlossen, aber beschränkt; hinsichtlich der technischen Fragen sollte das Ergebnis des Schiedsgutachtens Verbindlichkeit entfalten. Das erstinstanzliche Gericht und auch das Berufungsgericht sind deswegen auf die Prüfung beschränkt gewesen und weiter beschränkt, ob entweder eine Haftung der Beklagten zu 2) auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des Schiedsgutachters begründet ist oder ob die Voraussetzungen für die Unverbindlichkeit des Schiedsgutachtens vorliegen.
2. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Schiedsgutachterverfahrens kann eine schuldhafte Verletzung von Leistungspflichten der Bauüberwachung durch die Beklagte zu 2) nicht festgestellt werden.
a) In ihrem Schiedsgutachten stellte die B. zwar Schäden an den Abgaswärmetauschern durch Kondensatwasser aus dem Abgas fest, insbesondere Lochkorrosion und Rissbildungen im Bereich der – handwerklich ordnungsgemäß ausgeführten – Schweißnähte. Die B. diskutierte als mögliche Schadensursachen eine unzureichende Kondensat-Abführung und eine thermische Überbelastung der Rohrwandungen. Auf Nachfragen der Klägerin antwortete sie, dass eine nennenswerte Kondensatmenge nur außerhalb des jeweils geschädigten Bauteils – des Abgaswärmetauschers – im Modul entstehen könne, dass sie aber über die Ursachen dieses Kondensatzuflusses in den Abgaswärmetauscher ohne Kenntnis der jeweiligen Betriebszustände der Gesamtanlage nur spekulieren könne. Als mögliche Ursachen gab sie zwar einerseits auch Mängel in der Planung und in der Ausführung der Bauarbeiten an, welche möglicherweise einen Bezug zur Tätigkeit der Beklagten zu 2) aufweisen könnten. Andererseits schloss sie aber auch Mängel in der Wartung (durch die Beklagte zu 1) oder in der Art der Betriebsführung des Kraftwerks (durch die Klägerin) als Ursachen nicht aus. Nach diesem Gutachtenergebnis ist eine schuldhafte Pflichtverletzung der Beklagten zu 2) nicht festzustellen.
b) Diese erstinstanzliche Bewertung im Urteil stellt keine Überraschungsentscheidung dar. Vielmehr hat das Landgericht in der Sitzung vom 02.08.2004 ausdrücklich darauf hingewiesen und die Prozessparteien haben dies auch so verstanden, wie die Ausführungen der Beklagten zu 1) im Schriftsatz vom 25.11.2004, diejenigen der Beklagten zu 2) in den Schriftsätzen vom 07.09.2004 und vom 14.12.2004 sowie diejenigen der Klägerin in deren Schriftsätzen vom 13.09.2004 und vom 31.01.2005 zeigen. Das Landgericht hat seinen Hinweis in der Sitzung vom 24.10.2006 wiederholt.
3. Das Landgericht ist auch zu Recht von der Verbindlichkeit des Schiedsgutachtens ausgegangen. Die vereinbarten Voraussetzungen für eine Unverbindlichkeit liegen entgegen der Auffassung der Klägerin nicht vor. a) Die Klägerin beruft sich einerseits auf die Unvollständigkeit des Schiedsgutachtens im Hin blick auf die Mängel an der Schornsteinanlage. Ein Schiedsgutachten kann aber nicht schon deshalb als offenbar unrichtig angesehen werden, weil der Schiedsgutachter die ihm gestellte Aufgabe angeblich nicht vollständig erfüllt habe. Es hätte den Beteiligten des Schiedsgutachterverfahrens, hier insbesondere der Klägerin, freigestanden, diese Unvollständigkeit durch Ergänzungsfragen herauszustellen und den Schiedsgutachter zu weiteren Antworten zu bewegen. Ein unrichtiges Ergebnis der Begutachtung durch die B. im Hinblick auf die Schornsteinanlage rügt die Klägerin nicht. b) Die Klägerin führt andererseits an, dass der Schiedsgutachter die Ursachen der von ihm festgestellten Mangelerscheinungen nicht mit der für eine Prozessführung gegen die Beklagten zu 1) und zu 2) notwendigen Eindeutigkeit festgestellt habe. Die B. hat auf Ergänzungsfragen der Klägerin angegeben, dass und aus welchen Gründen sie eine weitergehende Feststellung nicht habe treffen können. Der teilweise mit denselben Beweisgegenständen betraute gerichtliche Sachverständige kam nur auf der Grundlage neuer Anknüpfungstatsachen zu weitergehenden Erkenntnissen. Anders als die Schiedsgutachter war sein Untersuchungsbereich auf die gesamte Abgasanlage ausgedehnt und insbesondere auf die Sekundärschalldämpfer, deren fehlerhafte Konstruktion und unzureichende Werkstoffauswahl ganz überwiegend sowohl zur Feuchtigkeitsproblematik einschließlich der Korrosionserscheinungen als auch zur Überschreitung des Grenzwertes für den – an den Motoren ankommenden – Abgasgegen druck beitrug. Der gerichtliche Sachverständige hatte die Möglichkeit, die ausgebauten und inzwischen geöffneten Bauteile zu besichtigen, insbesondere das Innere eines Sekundärschalldämpfers in Augenschein zu nehmen. Aufgrund dieser zusätzlichen Erkenntnismöglichkeiten gelangte er zu genaueren Aussagen. Es lässt aber das Schiedsgutachten nicht als offenbar unrichtig erscheinen, denn für die Beurteilung dieser Frage ist darauf abzustellen, welche Erkenntnismöglichkeiten dem Schiedsgutachter zur Verfügung standen.
III. Das Landgericht hat zu Recht darauf erkannt, dass die Klägerin zu den Voraussetzungen für eine Sekundärhaftung der Beklagten zu 2) bezüglich etwaiger Mängel der Bauüberwachung keinen hinreichenden Sachvortrag gehalten hat.
1. Anknüpfungspunkt für die Sekundärhaftung des Architekten bzw. Ingenieurs ist dessen Sachwalterstellung für den Bauherrn im Rahmen des übernommenen Aufgabenkreises. Dem umfassend mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten oder Ingenieur obliegt im Rahmen seiner Betreuungsaufgaben nicht nur die Wahrung der Auftraggeberrechte gegenüber dem Bauunternehmer, sondern auch und zunächst die objektive Klärung von Mangelursachen, selbst wenn zu diesen eigene Planungs- oder Aufsichtsfehler gehören. Die dem Architekten bzw. Ingenieur vom Bauherrn eingeräumte Vertrauensstellung gebietet es, diesem im Laufe der Mängelursachenprüfung auch Mängel des eigenen Werks zu offenbaren, so dass der Bauherr seine Auftraggeberrechte auch gegen den Bauüberwacher rechtzeitig vor Eintritt der Verjährung wahrnehmen kann (vgl. BGH, Urteil v. 16.03.1978, VII ZR 145/76, BGHZ 71, 144; BGH, Urteil v. 04.10.1984, VII ZR 342/83, BGHZ 92, 251; BGH, Urteil v. 10.12.2009, VII ZR 42/08, BGHZ 183, 323). Ist die sog. Sekundärhaftung begründet, so führt sie dazu, dass sich der Architekt bzw. der Ingenieur nicht auf die Einrede der Verjährung des gegen ihn gerichteten Gewährleistungsanspruchs berufen darf (vgl. auch Dölle in: Werner, Der Bauprozess, 16. Aufl. 2016, Rn. 2868 m.w.N.).
2. Eine Sekundärhaftung des Bauüberwachers kommt insbesondere dann in Betracht, wenn er es nach dem Auftreten einer konkreten Mangelerscheinung unterlässt, deren Ursachen entschieden und ohne Rücksicht auf eine mögliche eigene Haftung nachzugehen, und dadurch dem Bauherrn nicht rechtzeitig vor dem Eintritt der Verjährung der Gewährleistungsansprüche ein zutreffendes Bild der Schadensbehebung zu verschaffen (vgl. BGH, Urteil v. 16.03.1978, VII ZR 145/76, BGHZ 71, 144; vgl. auch Werner/ Frechen in: Werner, Der Bauprozess, 16. Aufl. 2018, Rn. 2025 m.w.N.). Hierfür trägt die Klägerin als Bauherr die Darlegungs- und Beweislast.
a) Der Senat geht von einer Verjährung von etwaigen Gewährleistungsansprüchen der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) nur hinsichtlich solcher Mängel aus, die erstmals nach der Abnahme in Erscheinung getreten waren. Deren Ursachen, insbesondere die fehlerhafte Konstruktion des Inneren der Sekundärschalldämpfer, konnten mit den Erkenntnismöglichkeiten vor dem Rückbau des BHKW ganz überwiegend nicht ermittelt werden. Soweit die Klägerin in ihrer Berufungsbegründung auf ein Schreiben der Sch. & Partner Vertrieb GmbH vom 23.03.2001 (Anlage K 60, GA Bd. VI Bl. 192 ff.) verwiesen hat, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Das Schreiben stammte von einem Anbieter eines Schalldämpfersystems, welcher zwar von der Beklagten zu 1) zu einer Angebotsabgabe als Lieferant aufgefordert wurde, den Auftrag dann aber nicht erhielt. Der bloße Umstand, dass er selbst sein Angebot für technisch reifer als das Angebot der Mitbewerberin erachtete, musste der Beklagten zu 2) keinen Anhaltspunkt dafür vermitteln, dass das letztlich von der Beklagten zu 1) ausgewählte und zum Einbau bestellte Schalldämpfersystem bzw. einzelne Komponenten davon den anerkannten Regeln der Technik nicht entsprachen. Das Schreiben beinhaltete zudem vor allem die Darstellung der Chronologie der Vergabeverhandlungen zwischen der Beklagten zu 1) und den in Betracht kommenden Bietern hinsichtlich der Beschaffung der gesamten (mehrstufigen) Schalldämpferanlage, welche erkennen lässt, dass die Verfasserin die Beklagte zu 1) dadurch vom eigenen Angebot zu überzeugen versuchte, dass sie das Angebot der Mitbewerberin pauschal als zweifelhaft darstellte. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass oder gar in welcher Hinsicht die Komponenten der Schalldämpferanlage der Mitbewerberin S. , welche letztlich von der Beklagten zu 1) als Lieferantin ausgewählt wurde, den anerkannten Regeln der Technik nicht entsprachen, gingen aus dem Schreiben nicht hervor; vielmehr wandte sich die Konkurrentin gegen eine Überwertung des günstigsten Angebotspreises im Hinblick auf mögliche Folgekosten (S. 2: „Das Angebot der Fa. S. war aufgrund der dort angegebenen technischen Daten zweifelhaft.“, S. 3: „Herr Sch. teilte mit, daß, falls das „S. -Konzept“ realisiert würde, später ein dritter Abgasschalldämpfer nachgerüstet werden muß und dadurch erhebliche Probleme durch den dann zu hohen abgasseitigen Widerstand auftreten würden. Es sei mit zusätzlichen Kosten von mind. 150 TDM zu rechnen. Das Konzept „S. “ käme deshalb auf gar keinen Fall in Frage.„). Maßgeblich ist aus Sicht des Senats, dass die Mangelhaftigkeit der Sekundärschalldämpfer objektiv darauf beruhte, dass die tatsächliche Ausführung selbst von den Plänen der Lieferantin abwich, was jedoch auch für die Fa. Sch. nicht zu erkennen war.
b) Im Rahmen der Bauüberwachung während der Errichtung des BHKW kommt allenfalls eine Verletzung der rechtzeitigen Prüfung und Weiterleitung der technischen Zeichnung der Lieferantin der Sekundärschalldämpfer (Anlage K 6, GA Bd. I Bl. 137) in Betracht. Diese hätte zwar nicht zur Entdeckung der konstruktiven Mängel geführt, aber den Einsatz eines unzureichenden Werkstoffs für das Gehäuse aufgezeigt. Insoweit ist darauf zu verweisen, dass es Aufgabe der Beklagten zu 2) im Rahmen der Bauüberwachung war zu prüfen, ob die von der Beklagten zu 1) – bzw. ihrer Lieferantin – eingesetzten Werkstoffe die notwendige Qualität für eine ordnungsgemäße Erfüllung der entsprechenden Bauleistung aufwiesen bzw. – wenn, wie hier, der Einsatz bestimmter Werkstoffe zwingend vorgegeben ist („Edelstahl“) – festzustellen, ob diese auch tatsächlich verwendet wurden (vgl. Werner/ Frechen, a.a.O., Rn. 2016 m.w.N.). Insoweit hat aber die Klägerin, wie das Landgericht in seinem Urteil ausgeführt und was sie selbst in der Berufungsinstanz nicht angegriffen hat, in dem Prozessrechtsverhältnis zur Be klagten zu 2) gerade nicht vorgetragen (bzw. sich das Vorbringen der Beklagten zu 1) zu eigen gemacht), dass die Beklagte zu 2) diese Unterlagen vollständig und rechtzeitig vor dem Abnahmetermin erhalten und versäumt habe, die eindeutig erkennbare Angabe zum eingesetzten Werkstoff für das Gehäuse als vertragswidrig zu rügen. Sie hat vielmehr offengelassen, ob die Beklagte zu 2) diese Planzeichnung überhaupt vor dem Termin der Abnahme am 30.12.1997 erhalten hat, und vorgetragen, dass jedenfalls sie selbst eine Sichtung der zu einem nicht mehr bestimmbaren Zeitpunkt an sie weitergeleiteten Unterlagen erst im Jahre 2003 vorgenommen habe. Hieraus ergibt sich kein zwingender Schluss auf eine schuldhafte Pflichtwidrigkeit der Beklagten zu 2).
IV. Die Klägerin hat die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung gegen die Beklagte zu 2) wegen mangelhafter Objektbetreuung i.S.d. Leistungsphase 9 nicht schlüssig dargelegt. Hierfür hätte es insbesondere der Darlegung einer konkreten Pflichtverletzung der Beklagten zu 2) bzw. der von ihr als Erfüllungsgehilfin eingeschalteten Streithelferin der Beklagten zu 2) bedurft, an der es auch in der Berufungsinstanz fehlt. Die Klägerin hat letztlich nur vorgetragen, dass die sich über Jahre hinwegziehende Fehlersuche und Fehlerbeseitigung nicht zu einem einwandfreien Betrieb des BHKW geführt habe. Welchen konkreten Vorwurf sie im Hinblick auf die Objektbetreuung erheben will, hat sie nicht ausgeführt. Die Streithelferin der Beklagten zu 2) hat die Mängel- und Restpunkteliste sukzessive aktualisiert und deren Abarbeitung angeleitet. Dass ihr Fehler in der Dokumentation unterlaufen seien, hat die Klägerin nicht geltend gemacht. Die Klägerin hat auch nicht etwa eine unterlassene oder zu zögerliche Ansprache der Beklagten zu 1) beanstandet oder einen konkreten Fehler bei der Ausführung der Mangelbeseitigungs- bzw. Resterfüllungsaufgaben. Die Streithelferin der Beklagten zu 2) hat solche nach der Abnahme erstmals auftretende Mängel, wie den zu hohen Abgasgegendruck (vgl. Anlage K 28) oder Risse im Sekundärschalldämpfer (Anlage K 31), jeweils unverzüglich gegenüber der Beklagten zu 1) angezeigt und zu deren Beseitigung aufgefordert. Sie hat ihrerseits umfassende Anstrengungen unternommen, um die Ursachen der Mangelerscheinungen aufzuklären. Welche Fehler ihr dabei unterlaufen sein sollen, legt die Klägerin nicht dar.
Komplex I insgesamt
I. Nach den Vorausführungen ist die Berufung der Klägerin bezüglich ihres Berufungsantrages zu Ziffer 1 unbegründet.
II. Soweit die Klägerin ursprünglich als Klageantrag zu Ziffer 2 die Feststellung begehrt hat, dass die Beklagten zu 1) und zu 2) als Gesamtschuldner verpflichtet seien, ihr den Schaden zu ersetzen, der ihr aus der fehlerhaften und planwidrigen Erstellung des BHKW entstanden sei und noch entstehen werde, hat sie ihren Antrag, nachdem die Erledigungserklärung in der Berufungsbegründung (S. 40, GA Bd. XI Bl. 260) einseitig geblieben ist, auf Feststellung, dass der ursprüngliche Klageantrag zu Ziffer 2 vor dem Abriss des BHKW zulässig und begründet gewesen sei und sich durch den Abriss des BHKW erledigt hat, umgestellt. Dieser Feststellungsantrag ist zulässig, aber nach den Vorausführungen unbegründet. Eine derartige, gerichtlich durchsetzbare Verpflichtung der Beklagten zu 1) und zu 2) besteht nicht.
Komplex II
I. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) in Bezug auf den Berufungsantrag zu Ziffer 2) einen Anspruch auf Rückzahlung von 101.902,99 Euro aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB.
1. Die Beklagte zu 1) erlangte in den Jahren 2001 und 2002 durch Zahlungen der Klägerin an sich selbst insgesamt 58.643,80 Euro und durch Zahlungen der Klägerin an die D. AG, der Beklagten zu 1) zurechenbar, insgesamt 43.259,19 Euro.
a) Die Klägerin zahlte an die Beklagte zu 1) auf diverse Rechnungen für Instandsetzungsarbeiten im Jahr 2001 insgesamt 7.792,45 Euro (vgl. LGU S. 8 ff. zu lfd. Nr. 8, 12, 17 und 23) und im Jahr 2002 insgesamt 18.665,83 Euro (vgl. lfd. Nr. 32, 46, 52 und 53). Insoweit beruhten die Arbeiten der Beklagten zu 1) auf Störungsmitteilungen der Klägerin; die Erteilung gesonderter, d.h. vom Umfang der Leistungspflichten des Wartungsvertrages unabhängiger und entgeltpflichtiger Einzelaufträge hat die Beklagte zu 1) insoweit weder dargelegt noch nachgewiesen. Für die Instandsetzungsarbeiten nach dem Vorfall 2 – Ausfall des Moduls 2 am 20.01.2003 wegen der Ablösung von Teilen am Sekundärschalldämpfer und an einem Kompensator zwischen Primär- und Sekundärschalldämpfer sowie wegen des erheblichen Anstiegs des Ab gasgegendrucks – zahlte die Klägerin an die Beklagte zu 1) 32.185,52 Euro unter dem Vorbehalt der Rückforderung (vgl. u.a. Anlage B 18, GA Bd. II Bl. 105).
b) Die Klägerin zahlte an die D. AG als Nachauftragnehmerin der Beklagten zu 1) direkt auf diverse Rechnungen für Instandsetzungsarbeiten im Jahr 2001 insgesamt 23.425,88 Euro (vgl. LGU S. 8 ff. zu lfd. Nr. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 und 22) und im Jahr 2002 insgesamt 19.833,31 Euro (vgl. lfd. Nr. 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 47,48, 49, 50 und 58). Insoweit ist darauf zu verweisen, dass die D. AG als Motorenherstellerin bereits während der Errichtung des BHKW als Nachauftragnehmerin der Beklagten zu 1) tätig geworden war. Nachdem die Beklagte zu 1) bei Störungsmeldungen bezüglich des Teilbereichs Energieumwandlung im Januar und Februar 2001 jeweils eine Eigenleistung verweigerte, wandte sich die Klägerin mit entsprechenden Störungsmeldungen jeweils direkt an die D. AG. Das Erlangte der Beklagten zu 1) ist darin zu sehen, dass sie selbst diese Rechnungen ihrer Nachauftragnehmerin nicht ausgleichen musste.
c) Ebenso wie das Landgericht (vgl. LGU S. 79) sieht auch der Senat die Zahlungen der Klägerin an Drittunternehmen – mit Ausnahme der Fa. D. AG – nicht als Zahlungen an die Beklagte zu 1) an. Insoweit fehlt es auch in der Berufungsinstanz an einem substantiierten Vorbringen der Klägerin dazu, inwieweit die Beklagte zu 1) durch diese Zahlungen etwas er langt haben soll.
d) Soweit die Klägerin mit ihrer Klageerweiterung vom 20.12.2004 (GA Bd. V Bl. 85) zusätzlich die Zahlung von insgesamt 15.276,97 Euro für die Instandsetzung der Abgaswärmetauscher geltend gemacht hat, ist darauf zu verweisen, dass dieser Betrag bereits Gegenstand der für das Jahr 2002 insgesamt an die Beklagte zu 1) geleisteten Zahlungen ist (vgl. die im LGU S. 13 zu lfd. Nr. 52 aufgeführte Rechnung, in Anlagenkonvolut K 36, GA Bd. III Bl. 120).
2. Die von der Klägerin erbrachten Zahlungen erfolgten ohne Rechtsgrund. Sämtliche in den bezahlten Rechnungen abgerechneten Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten sowie die hierfür eingesetzten Materialien waren bereits mit der quartalsweise zu zahlenden Vergütung nach dem Wartungs- und Instandhaltungsvertrag vom 20.05.1998 abgegolten. Der Senat geht – insoweit abweichend von der Auffassung des Landgerichts – davon aus, dass der Wartungs- und Instandhaltungsvertrag zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) vom 20.05.1998 (künftig verkürzt: Wartungsvertrag) auch Instandsetzungsleistungen umfasste.
a) Bezüglich der prozessrechtlichen Bindungswirkungen nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO nimmt der Senat Bezug auf die Vorausführungen, wonach dem Berufungsgericht eine eigenständige Auslegung des Wartungsvertrages auf der Grundlage der vom Landgericht getroffenen Feststellungen obliegt. Es kommt auf eine umfassende Deutung des zwischen den Parteien geschlossenen Wartungsvertrages an, die nicht allein am Wortlaut stehen bleiben darf.
b) Zunächst ist darauf zu verweisen, dass es für die Vertragsauslegung ohne Relevanz bleibt, dass die Klägerin eingeräumt hat, für die Gesamtanlage am Standort eine Maschinenversicherung abgeschlossen zu haben. Der Umfang der Risikoabsicherung durch die Klägerin lässt keinen sicheren Rückschluss darauf zu, welcher Leistungsumfang dem im Mai 1998 mit der Beklagten zu 1) abgeschlossenen Vertrag zugrunde gelegen haben mag, zumal die Klägerin unwidersprochen ausgeführt hat, dass der Wartungsvertrag nicht sämtliche technischen Anlagen am Standort erfasse.
c) Auch der Zusammenhang zwischen dem Bauvertrag und dem Wartungsvertrag des Inhalts, dass die Gewährleistungsfrist im Bauvertrag gegenüber den Gewährleistungsfristen nach der VOB/B verlängert wurde unter der Bedingung des Abschlusses eines exklusiven Wartungsvertrages, ist für die Auslegung des Wartungsvertrages ohne Belang. Es entspricht der Wertung des § 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B 1996, dass bei gleichzeitiger Übertragung der Wartung für die Dauer der Gewährleistung auf den Bauunternehmer eine Verlängerung der Gewährleistung gilt, was sich unmittelbar daraus erklärt, dass bei einer ordnungsgemäß gewarteten technischen oder baulichen Anlage regelmäßig eine stabilere Funktionalität und eine längere Lebensdauer zu erwarten ist und es der Unternehmer selbst in der Hand hat, die Erhaltung des Soll-Zustandes zu gewährleisten.
e) Ist ein Wartungsvertrag Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung gewesen, so kommt dem Wortlaut der Leistungsbeschreibung vergleichsweise große Bedeutung zu (vgl. BGH, Urteil v. 09.10.1997, VII ZR 259/95, BGHZ 134, 245; BGH, Urteil v. 22.12.2011, VII ZR 67/11, BGHZ 192, 172). Das gilt auch im vorliegenden Fall.
aa) Hinsichtlich des Wortlauts des gesamten Wartungsvertrages ist zunächst anzumerken, dass der Senat zwei Umständen keine bzw. allenfalls eine sehr untergeordnete und von anderen Aspekten verdrängte Bedeutung beimisst. Einerseits folgt der Senat dem Landgericht in seiner entsprechenden Bewertung des Umstandes, dass in den vorformulierten Textbestandteilen z.T. die Worte „Leistungsverzeichnis Bereich Standard-Wartungsvertrag“ enthalten waren. Insoweit wird auf die Entscheidungsgründe (vgl. LGU, Abschnitt B. III. 1., S. 73) Bezug genommen. Andererseits bezeichneten die Parteien ihren Vertrag in der Überschrift als „Wartung und Instandhaltung der BHK-Anlage und periphere Anlagen“. Insoweit gehen die Prozessparteien selbst übereinstimmend von einer Ungenauigkeit aus, unabhängig davon, dass sie den Vertrag unterschiedlich auslegen. Nach dem Verständnis der technischen Normen (dazu nachfolgend) umfasst die Instandhaltung als einen Teilbereich auch die Wartung, daneben aber auch weitere Bereiche, wie Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung. Nach dem in der Praxis weit verbreiteten Verständnis soll Wartung der Oberbegriff sein und die Instandhaltung einschließen. Es ist gerichtsbekannt, dass auf dem Markt die Bezeichnungen von Wartungsverträgen variieren und die unter dem Begriff Wartung angebotenen oder abgefragten Leistungen je nach Anbieter oder Nachfrager ein sehr unterschiedliches Leistungsspektrum aufweisen (vgl. nur Schneider/ Kahlert in: Schneider, Handbuch EDV-Recht, 5. Aufl. 2017, P. Hardwarewartungsverträge Rz. 2 und 8). Der Senat sieht daher auch in der Bezeichnung des Vertrages kein belastbares Indiz für die eine oder andere Auslegung.
bb) Entgegen der Auffassung des Landgerichts sind die in der Präambel des Wartungsvertrages aufgeführten Vertragsziele durchaus geeignet, auf eine Einbeziehung der Instandsetzung in den Vertrag zu schließen. Als letzte Anstriche wurden dort die Gewährleistung eines sicheren Anlagenbetriebes und die (dauerhafte) Einhaltung der zugesicherten Eigenschaft „Verfügbarkeit“ genannt. Damit korrespondiert, dass der Vertrag in Ziffer 2 Abs. 3 eine Reaktionszeit des Auftragnehmers definiert. Beschränkte sich der Vertrag lediglich auf periodisch, nach Zeiteinheiten oder nutzungsabhängig zu erbringenden Regelwartungs- und Instandhaltungsmaß nahmen im engeren Sinne, so wäre diese Regelung überflüssig gewesen. Die Festlegung von Reaktionszeiten deutet im Lichte des Vertragsziels Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit darauf hin, dass dem Auftragnehmer auch solche von Abrufen oder Fehlermeldungen der Auftraggeberin abhängige Vertragsleistungen übertragen wurden.
cc) Maßgeblich ist für den Senat einerseits, dass die Klägerin die Vergabe des Wartungsauftrages mit der in Ziffer 2 aufgeführten Leistungsbeschreibung ursprünglich nach Maßgabe der VOB ausgeschrieben hatte, so dass für die Auslegung auf den Empfängerhorizont eines fachkundigen Bieters abzustellen war und für das Begriffsverständnis ergänzend die VOB/C und deren Bestandteile heranzuziehen sind, soweit sich keine ausdrücklichen Abweichungen aus dem Vertragstext selbst ergeben. Insoweit kommt dem Begriffsverständnis der DIN 31051 – Grundlagen der Instandhaltung – eine besondere Bedeutung zu. Danach ist Instandhaltung, welche im Wartungsvertrag vom 20.05.1998 durchgängig als geschuldete Leistung benannt wird, ein Oberbegriff, welcher sich in Wartung – häufig i.S. von vorbeugender Wartung -, Inspektion und Instandsetzung untergliedert und die Instandsetzung als Wiederherstellung des für den Betrieb der Anlage erforderlichen Soll-Zustandes nach Störungen, Schäden oder sonstigen Abweichungen einschließt (vgl. dazu Schneider/Kahlert, a.a.O., Rz. 6 f.). Anders, als Inspektionen oder vorbeugende Wartungsmaßnahmen erfolgen Instandsetzungsarbeiten aufgrund des Abrufs des Kunden bzw. auf dessen Fehlermeldung.
dd) Bedeutsam ist andererseits, dass die in Ziffer 2 – Leistungen des AN – sowohl im Hinblick auf die Leistungen innerhalb der Gewährleistungszeit (Absatz 1) als auch im Hinblick auf die Leistungen nach Ablauf der Gewährleistungszeit (Absatz 2) definierten Leistungsumfänge als „die Regelwartungsleistungen sowie sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsleistungen (auch in Bezug auf Verschleißteile)“ (Unterstreichungen durch den Senat) definiert. Damit unterscheiden die Vertragsparteien in Ziffer 2 deutlich drei Kategorien, Regelwartung, Instandhaltung (offenkundig nicht als Oberbegriff, sondern im engeren Sinne als periodisch oder nach einem Zeitplan oder nutzungsabhängig gemäß den Vorschriften des Herstellers der Anlage teile zu erbringende Leistungen) und Instandsetzungen als abrufabhängige Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft. Die Parteien vereinbarten ausdrücklich, dass der Austausch von Verschließteilen eingeschlossen ist. Insoweit ist jedoch die gesonderte Vereinbarung der Parteien im Vergabegespräch vom 07.05.1997 (in Anlage K 2, GA Bd. I Bl. 25 ff.) unter Ziffer 7 zu berücksichtigen, wonach sich das Wartungsangebot der Beklagten zu 1) bezüglich der Motoren darauf beschränkte, dass in dem Wartungspreis ihres Angebotes die Kosten für den Ersatz von Zündkerzen nur für den Austausch nach der garantierten Standzeit von 1.500 Bh und der Regelerwartung von 3.000 Bh enthalten seien.
ee) Der Umstand, dass dem Wartungsvertrag vom 20.05.1998 Anlagen beigefügt sind, welche insbesondere die Regelwartungsleistungen und die Inspektionen konkretisieren, spricht, anders als die Beklagte zu 1) meint, nicht gegen die Einbeziehung von Instandsetzungsleistungen in das jeweilige – durch die Regelvergütung abgegoltenen – Leistungsspektrum. Hinsichtlich dieser Regelleistungen war eine Untersetzung und genaue Definition möglich und zweckmäßig, weil die Erforderlichkeit der Maßnahmen unabhängig von den Besonderheiten des künftigen Betriebes abhing. Hinsichtlich der Instandsetzungsarbeiten wäre jede Untersetzung unvollständig gewesen, weil die Vielfalt der möglichen Störungen, Ausfälle und Abweichungen vom Soll-Zustand einer betriebsbereiten Anlage nicht zu erfassen war.
ff) Die pauschale Vergütungsregelung wurde in Abhängigkeit von der Anzahl der Betriebsstunden je Modul getroffen. Soweit die Beklagte zu 1) eingewandt hat, dass eine solche Vergütungsregelung schon per se dafürspreche, dass mit ihr nur periodisch, nach Zeitplan oder nutzungsabhängig zu erbringende Leistungen erfasst seien, folgt der Senat dem nicht. Einem fachkundigen Unternehmen ist zuzumuten, durch angemessene Zuschläge auch den durch schnittlichen Instandsetzungsaufwand einzukalkulieren. Die weitere Einwendung der Beklagten zu 1), dass der konkret angebotene Preis je Betriebsstunde auf eine auf Instandhaltung im engeren Sinne und Regelwartung begrenzte Leistung schließen lasse, überzeugt nicht. Einerseits hat die Klägerin durch substantiierten Vortrag, insbesondere durch Verweis auf die Broschüre der Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. (Anlage K 51, GA Bd. IV Bl. 143 ff.) und im Schriftsatz vom 04.04.2008, dort ab S. 2 (GA Bd. VI Bl. 31 ff.) aufgezeigt, dass der angebotene Preis durchaus üblich für eine Vergütung einer sog. Vollwartung sei, andererseits sind für die Preisfindung der Beklagten zu 1), gerade auch in einer öffentlichen Ausschreibung, andere Aspekte als Auskömmlichkeit und angemessene Gewinnmargen nicht auszuschließen. Der weitere Umstand, dass das Regelentgelt in Ziffer 4 Abs. 2 von der Beklagten zu 1) nicht weiter aufgegliedert wurde und die Beklagte zu 1) die Preisanteile, welche auf bestimmte Einzelleistungen entfielen, nicht angab, ändert nichts an der Verbindlichkeit des Regelentgelts für sämtliche Kosten des Auftragnehmers für Lohn, Material, Reisekosten und Auslösungen.
f) Schließlich sprechen auch einige außerhalb der Urkunde liegende Umstände für die Richtigkeit der Auslegung durch den Senat. aa) Einerseits hat der an den Verhandlungen über den Wartungsvertrag beteiligte Zeuge C. R. (vgl. Sitzungsprotokoll v. 10.01.2018, GA Bd. X Bl. 96 ff.) zwar eingeräumt, dass er an die Vorgänge nach ca. 20 Jahren keine vereinzelte Erinnerung mehr habe, aber gleichwohl noch erinnerte, dass der Wartungsvertrag nicht auf den Austausch der Zündkerzen beschränkt war, sondern sämtliche Verschleißmaterialien erfasst habe. Diese Erinnerung stellt auch nicht nur eine individuelle Interpretation des Zeugen dar, sondern nach seiner Aussage eine von ihm wahrgenommene Einigkeit der Anwesenden. Die Angabe korrespondiert im Übrigen mit dem Text der Leistungsbeschreibung in Ziffer 2 des Wartungsvertrages. Die Regelung zu den Zündkerzen sei nur deswegen gesondert herausgegriffen worden, weil deren Austauschkosten häufig Streitpotenzial böten, weswegen diese Frage eindeutig habe geklärt werden sollen. Der Zeuge R. bestätigte mit seiner Aussage auch auf mehrfachen Vorhalt, dass der Vertrag als ein Vollleistungsvertrag gemeint gewesen sei und auf das permanente Erhalten eines betriebsfähigen Zustandes der Anlage gezielt habe. Es sei darum gegangen, sämtliche zur Erhaltung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Maßnahmen aus einer Hand zu bekommen.
bb) Andererseits ist unstreitig, dass die Vertragsparteien während der ersten drei Jahre der Laufzeit des Wartungsvertrages (1998 bis 2000) den Vertrag in dem vom Senat verstandenen Sinne abwickelten. Die Beklagte zu 1) erbrachte diverse Instandsetzungsleistungen, ohne sie separat in Rechnung zu stellen. Auch Materialkosten, insbesondere für Verschleißteile, wurden nicht in Rechnung gestellt. Die Beklagte zu 1) änderte ihr Verhalten nach dem (vermeintlichen) Ablauf der Gewährleistungsfrist am 30.12.2000. Insoweit ist jedoch darauf zu verweisen, dass die Regelungen in Ziffer 2 des Wartungsvertrages, welche zwischen dem Zeitraum der Gewährleistung und dem Zeitraum nach Ablauf der Gewährleistung differenzieren, im Hin blick auf den Umfang der geschuldeten Leistungen wortgleich sind und jeweils auch Instand setzungsarbeiten umfassen. Ausdrücklich verweigerte sie die Leistungserbringung ohne einen erneuten entgeltlichen Auftrag anlässlich der Aufforderung der Klägerin zur Instandsetzung nach dem Vorfall 2 am 20.01.2003, wie das Schreiben der Beklagten zu 1) vom 04.02.2003 (Anlage K 20, GA Bd. I Bl. 158) belegt.
cc) Der Auslegung des Senats steht nicht entgegen, dass die Klägerin in den Jahren 2001 und 2002 die Rechnungen der Beklagten zu 1) und diejenigen der D. AG jeweils ohne die Erklärung eines Vorbehalts bezahlte. Die bloße Begleichung der Rechnungen stellt grundsätzlich kein Anerkenntnis dar; ein solches liegt nur vor, wenn sich aus besonderen Umständen ergibt, dass die zahlende Partei damit die berechtigte Geltendmachung der Forderung bestätigen wollte. Hier fehlte es schon an einem Anlass für eine solche Bestätigung. Nach dem Vorfall 2 vom 20.01.2003 kam es erstmals zu einem offenen Streit über die Frage der Vergütung von Instandsetzungsleistungen der Beklagten zu 1), in diesem Streit nahm die Klägerin die auch im Rechtsstreit weiter vertretene Rechtsposition ein.
3. Die Rückzahlungsansprüche der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) sind nicht verjährt, weil sie bereits mit der Klageschrift vom 30.12.2003 rechtshängig geworden sind; das steht zwischen den Prozessparteien nicht im Streit.
4. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) Anspruch auf Zahlung sog. Prozesszinsen nach §§ 291 i.V.m. 288 Abs. 2 BGB a.F. Da die Klage vom 30.12.2003, welche auf einen höheren Betrag dieser Klageforderungen gerichtet war, der Beklagten zu 1) am 02.02.2004 zugestellt worden ist (vgl. GA Bd. I Bl. 164), beginnt die Verzinsung nach § 187 Abs. 1 BGB am 03.02.2004. Im Übrigen unterliegt der Zinsantrag der Abweisung.
II. Das Landgericht hat zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen darauf erkannt, dass die Klägerin gegen die Beklagte zu 1) in Bezug auf den Berufungsantrag zu Ziffer 2) weiter einen Anspruch auf Rückzahlung von 32.654,98 Euro aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB hat.
1. Dieser Anspruch bezieht sich auf überzahlte Vergütung für Wartungsarbeiten in den Jahren 2001 bis 2003 aufgrund einer fehlerhaften Anwendung der im Wartungsvertrag enthaltenen Preisgleitklausel (vgl. GA Bd. V Bl. 7 f. sowie Anlagen K 53 bis K 55, GA Bd. V Bl. 9 bis 11). Der Senat macht sich die Erwägungen des erstinstanzlichen Gerichts (LGU, Abschnitt B. IV., S. 79 f.), die im Berufungsverfahren nicht mehr angegriffen worden sind, zu eigen. Insbesondere führten die jeweilige Ankündigung der Erhöhung (vgl. u.a. B 25, GA Bd. V Bl. 117 ff.) durch die Beklagte zu 1) und die hierauf erfolgte vorbehaltlose Zahlung der Klägerin nicht etwa zu einem bestätigenden Anerkenntnis.
2. Auch bezüglich dieser Rückforderung ist die Einrede der Verjährung unbegründet, weil die Klageforderung am 20.12.2004 durch Antragstellung im Termin (vgl. GA Bd. V Bl. 77 f.) rechts hängig geworden ist.
3. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) Anspruch auf Zahlung sog. Prozesszinsen nach §§ 291 i.V.m. 288 Abs. 2 BGB a.F. Da die Klageerweiterung vom 22.12.2009 der Beklagten zu 1) am 08.02.2010 zugestellt worden ist (vgl. GA Bd. I Bl. 164), beginnt die Verzinsung nach § 187 Abs. 1 BGB am 09.02.2010.
III. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) bezüglich des Berufungsantrags zu Ziffer 3 einen bereicherungsrechtlichen Anspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB auf Rückzahlung von real aufgewandten Kosten für Instandsetzungsarbeiten in den Jahren 2003 bis 2009 in Höhe von insgesamt 235.439,38 Euro und einen vertraglichen Anspruch auf Schadensersatz wegen der Kosten der Selbstvornahme nach §§ 280 Abs. 1, 281 BGB in Höhe von insgesamt 32.270,36 Euro. Im Übrigen ist die mit dem Berufungsantrag zu Ziffer 3 verfolgte Klageforderung als unbegründet abzuweisen.
1. Die Beklagte zu 1) erlangte in den Kalenderjahren 2003 bis 2009 durch Zahlungen an sich selbst insgesamt 69.257,00 Euro und durch ersparte Aufwendungen gegenüber ihrer Nachauftragnehmerin der D. -Gruppe insgesamt 166.182,38 Euro
a) Die Klägerin leistete an die Beklagte zu 1) Zahlungen für Instandsetzungsleistungen im Jahr 2005 in Höhe von 19.680,49 Euro (vgl. LGU S. 16 zu lfd. Nr. 78), im Jahr 2007 in Höhe von 13.876,99 Euro (vgl. LGU S. 19 zu lfd. Nr. 105, 114) und im Jahr 2008 in Höhe von 35.699,52 Euro (vgl. LGU S. 22 zu lfd. Nr. 123, 124, 125, 126, 131).
b) Die Klägerin zahlte an die Nachauftragnehmerin der Beklagten zu 1) – wechselnd firmierend in den Jahren 2003 bis 2005 als D. AG, in den Jahren 2006 bis 2008 als D. Power Systems GmbH & Co. KG und im Jahr 2009 als V. GmbH – unmittelbar im Jahr 2003 einen Betrag von 1.287,50 Euro (vgl. LGU S. 14 zu lfd. Nr. 61), im Jahr 2004 insgesamt 8.358,14 Euro (LGU S. 14 f. zu lfd. Nr. 66, 73, 75), im Jahr 2005 insgesamt 5.153,60 Euro (LGU S. 15 ff. zu lfd. Nr. 76, 81), im Jahr 2006 insgesamt 62.035,84 Euro (LGU S. 17 ff. zu lfd. Nr. 89, 90, 93, 96, 97, 98), im Jahr 2007 insgesamt 14.352,12 Euro (LGU S. 19 ff. zu lfd. Nr. 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 117, 118, 119, 120), im Jahr 2008 insgesamt 35.525,76 Euro (LGU S. 23 ff. zu lfd. Nr. 127, 128, 132, 138, 150, 151, 152) und im Jahr 2009 insgesamt 39.469,42 Euro (LGU S. 27 ff. zu lfd. Nr. 155, 156, 157, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180).
2. Nach den Vorausführungen erfolgte der Vermögenszuwachs bei der Beklagten zu 1) ohne Rechtsgrund, weil sie nach dem Inhalt des Wartungsvertrages vom 28.05.1998 verpflichtet war, die abgerechneten Leistungen ohne gesondertes Entgelt zu erbringen.
3. Diese Ansprüche sind nicht verjährt, denn die Klägerin hat mit der Klageschrift vom 30.03.2003 einen Feststellungsantrag (zu Ziffer II. 2 der Klageschrift) gestellt, mit dem sie etwaige künftige bereicherungsrechtliche Ansprüche rechtshängig gemacht hat.
4. Soweit die Klägerin Zahlungen an Drittunternehmen leistete, hat sie nur teilweise darzulegen vermocht, dass die Beauftragung der Drittunternehmen als Ersatzvornahme wegen einer Weigerung der Beklagten zu 1) zur entgeltfreien Durchführung dieser Arbeiten geschah.
a) Der Senat erachtet das jeweils nicht erheblich bestrittene Vorbringen der Klägerin in 19 Einzelfällen für hinreichend und nimmt insoweit auf die Feststellungen des Landgerichts Bezug (vgl. LGU S. 14 ff. zu lfd. Nr. 95; 115; 130, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 146, 147, 148; 163, 165, 167, 168, 174, 181). Hieraus ergibt sich ein Schadensersatzanspruch in Höhe von insgesamt 32.270,36 Euro. Von diesem Gesamtbetrag entfallen 1.721,47 Euro auf das Jahr 2006, 2.635,46 Euro auf das Jahr 2007, 8.975,21 Euro auf das Jahr 2008 und 18.938,22 Euro für das Jahr 2009.
b) Im Übrigen fehlt es an einem hinreichenden Sachvortrag oder an einem Beweisangebot zu einer jeweils erfolglosen Aufforderung an die Beklagte zu 1) mit Fristsetzung bzw. an einem Vorbringen, warum dies im Einzelfall entbehrlich gewesen sein soll.
IV. Die nach den Vorausführungen begründeten Forderungen der Klägerin in Höhe von ins gesamt 402.267,71 Euro (101.902,99 Euro + 32.654,98 Euro + 235.439,38 Euro + 32.270,36 Euro) sind in Höhe von 117.212,44 Euro nach §§ 387, 389 BGB erloschen.
1. Die Beklagte zu 1) hat gegenüber den mit den Berufungsanträgen zu Ziffern 2 und 3 verfolgten Klageforderungen die Aufrechnung mit den mit der Widerklage geltend gemachten Gegenforderungen erklärt.
2. Aus den Vorausführungen des Senats zur Auslegung des Wartungsvertrages vom 28.05.1998 ergibt sich unmittelbar, dass ein Restbetrag aus der Rechnung der Beklagten zu 1) vom 25.03.2003 (Anlage B 18, GA Bd. II 105) nicht geschuldet ist, weil sich die Rechnung auf Instandsetzungsleistungen nach dem Vorfall 2 am 20.01.2003 bezieht. Darüber hinaus teilt der Senat die Auffassung des Landgerichts (LGU S.82), dass die Beklagte zu 1) im Rahmen ihrer Obliegenheit zur Substantiierung nach dem detaillierten Bestreiten der Klägerin (vgl. ins besondere auch Anlage K 52, GA Bd. IV Bl. 147) nicht vereinzelt dargelegt hat, weswegen eine höhere als die von der Klägerin rechnerisch bestätigte Summe von 32.185,52 Euro gerecht fertigt sein könnte.
3. Gleiches gilt für die Rechnungen der Beklagten vom 30.01.2002 (Anlage B 21, GA Bd. II Bl. 108), vom 26.03.2002 (Anlage B 20, GA Bd. II Bl. 107) und vom 15.11.2002 (Anlage B 19, GA Bd. II Bl. 106); sämtliche Rechnungen beziehen sich auf Instandsetzungsarbeiten, welche mit dem Regelentgelt des Wartungsvertrages abgegolten waren.
4. Dem gegenüber sind die Forderungen der Beklagten zu 1) aus ihren Rechnungen vom 01.10.2002 (Anlage B 15, GA Bd. II Bl. 102) in Höhe eines Restbetrages von 20.000,00 Euro, vom 31.12.2002/ 07.01.2003 (Anlage B 16, GA Bd. II Bl. 103) in Höhe eines Restbetrages von 15.897,44 Euro und vom 03.04.2003 (Anlage B 17, GA Bd. II Bl. 104) in Höhe von 81.315,00 Euro, insgesamt also in Höhe von 117.212,44 Euro begründet, denn diese Rechnungen beziehen sich auf das Regelentgelt nach dem Wartungsvertrag. Die Klägerin hat insoweit auch keine Einwendungen erhoben.
5. Der Senat teilt die Rechtsauffassung des Landgerichts, dass über die Hilfsaufrechnung der Klägerin mit Schadensersatzforderungen in Höhe von insgesamt 182.764,17 Euro wegen der Folgeschäden aus dem Vorfall 1 vom 11.12.2002 (vgl. Schriftsatz vom 20.07.2004, ab S. 2, GA Bd. III 156 ff.) nicht zu entscheiden ist, weil die Prozessparteien mit ihrer Vereinbarung vom 06./07.04.2005 (vgl. Anlage K 101, Klägeranlagenband I Bl. 174 f.) ein Aufrechnungsverbot bezüglich einerseits der Kosten der Generalüberholung der Anlage und andererseits der Vergütung für die durchzuführenden Arbeiten aus dem Wartungsvertrag vereinbarten. Die Rechnungen (Anlagen B 15 bis B 17) betreffen gerade die Vergütung aus dem Wartungsvertrag. Dieses Aufrechnungsverbot sollte erst enden, wenn über die Schadensersatzforderungen der Klägerin, welche Gegenstand der Hilfsaufrechnung sind, ein Vollstreckungstitel besteht. Die Erfüllung dieser Voraussetzung hat die Klägerin nicht vorgetragen.
6. Aus den Vorausführungen ergibt sich, dass die Widerklage unbegründet ist.
V. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) Anspruch auf Zahlung Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe nach §§ 286 Abs. 2 i.V.m. 288 Abs. 2 BGB a.F.
1. Die bereicherungsrechtlichen und schadensersatzrechtlichen Ansprüche der Klägerin für die Jahre 2003 bis 2006 umfassen insgesamt 98.237,04 Euro (1.287,50 Euro + 8.358,14 Euro+ 24.834,09 Euro + 62.035,84 Euro + 1.721,47 Euro) und sind durch die Aufrechnung vollständig erloschen. Hierauf sind keine Verzugszinsen zu zahlen.
2. Die entsprechenden Ansprüche der Klägerin für das Jahr 2007 betragen 30.864,57 Euro (28.229,11 Euro + 2.635,46 Euro), wovon durch die Aufrechnung 18.975,40 Euro (117.212,44 Euro – 98.237,04 Euro) erloschen sind, so dass 11.889,17 Euro verbleiben, die zu verzinsen sind.
3. Die Beklagte zu 1) ist in Verzug mit der Begleichung der begründeten Klageforderungen für das Jahr 2008 in Höhe von 80.200,49 Euro (71.225,28 Euro + 8.975,21 Euro) und für das Jahr 2009 in Höhe von 58.407,64 Euro (39.469,42 Euro + 18.938,22 Euro).
C.
I. Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen beruht auf §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 97 Abs. 1, 101 Abs. 1 ZPO.
II. Die weiteren Nebenentscheidungen ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 Satz 1 sowie 543, 544 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
III. Die Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO war nicht zuzulassen, da die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern.
IV. Die Festsetzung des Streitwerts für die Gebührenberechnung (Kostenwert) im Berufungsverfahren folgt aus §§ 39 Abs. 1, 47 Abs. 1 Satz 1, 48 Abs. 1 Satz 1, 63 Abs. 2 GKG i.V.m. § 3 ZPO.
Der Senat hat dabei den gegen beide Beklagte als Gesamtschuldner gerichteten Berufungsantrag zu 1) in Höhe der beiden bezifferten Teilforderungen von 998.391,23 Euro und 107.139,65 Euro sowie den Feststellungsantrag (einseitige Erledigungserklärung) gegen beide Beklagte in Höhe von 250.000,00 Euro in Ansatz gebracht. Er hat die jeweils gegen die Beklagte zu 1) allein gerichteten Anträge wie folgt bewertet: Den Berufungsantrag zu Ziffer 2 in Höhe der beiden bezifferten Teilforderungen von 146.296,77 Euro und 32.644,98 Euro, den Berufungsantrag zu Ziffer 3 in Höhe seiner Bezifferung mit 336.996,45 Euro und den Berufungsantrag zu Ziffer 4 (Widerklage) mit 94.932,62 Euro.