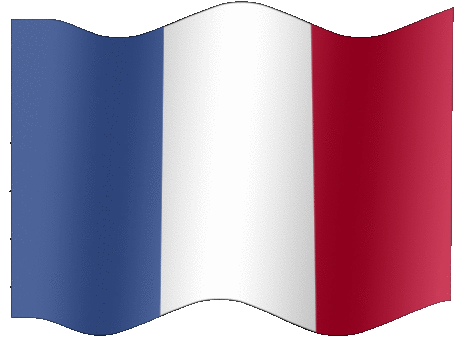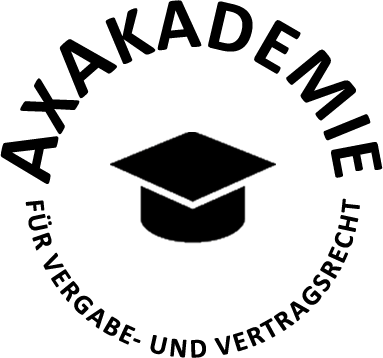vorgestellt von Thomas Ax
Aus dem Verweis in Art. 64 Abs. 6 Unterabs.1 Satz 1 der Richtlinie 2014/24/EU auf die Anforderungen des Art. 60 der Richtlinie ergibt sich, dass die inhaltlichen Anforderungen an die Eignung und die zu erbringenden Nachweise für jeden Bieter grundsätzlich gleich sein müssen, unabhängig davon, ob dieser präqualifiziert ist oder nicht (Anschluss an OLG Düsseldorf, Beschluss vom 08.06.2022 – Verg 19/22, IBRRS 2022, 1970 = VPRRS 2022, 0149).
Angesichts der weit verbreiteten Praxis öffentlicher Auftraggeber, bei präqualifizierten Bietern den Nachweis ihrer Eintragung in das Präqualifikationsverzeichnis als hinreichenden Nachweis ihrer Eignung genügen zu lassen, muss ein präqualifizierter Bieter nicht erkennen, dass er zum Nachweis seiner Eignung vergleichbare Nachweise wie ein nicht-präqualifizierter Bieter einreichen muss.
Dies gilt insbesondere dann, wenn in der Auftragsbekanntmachung hinsichtlich der Mindestanforderungen an die Eignung auf das Formblatt 124 verlinkt wird, das ausdrücklich als „Eigenerklärung zur Eignung für nicht nicht-präqualifizierte Bieter“ überschrieben ist und in den Bewerbungsbedingungen (Formblatt 212) ausdrücklich davon die Rede ist, dass präqualifizierte Unternehmen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag ins Präqualifikationsverzeichnis führen (Abgrenzung zu OLG Düsseldorf, Beschluss vom 08.06.2022 – Verg 19/22, IBRRS 2022, 1970 = VPRRS 2022, 0149).
Werden in einem Vergabeverfahren mehrere Fachgewerke zusammengefasst vergeben, darf nicht unklar bleiben, welche Leistungsbereiche die Präqualifikation eines Bieters umfassen muss und wie sich die Nachweisführung in jenen Fällen gestalten soll, in denen ein Bieter nur für einen Teil der einschlägigen Leistungsbereiche präqualifiziert ist.
VK Südbayern, Beschluss vom 27.02.2024 – 3194.Z3-3_01-23-61
Gründe:
I.
Mit Auftragsbekanntmachung vom 11.08.2023, veröffentlicht im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union am 16.08.2023 unter Nr. 2023/S …, schrieb der Antragsgegner einen Bauauftrag über das Gewerk „V-H2.1 Stahl Glas reduziert“ für den Neubau der Justizvollzugsanstalt, P…-K…, im Wege eines offenen Verfahrens aus. Abschnitt II.2.5) der Bekanntmachung beinhaltete die Angabe, dass der Preis nicht das einzige Zuschlagskriterium sei; alle Kriterien seien nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt. Die Abschnitte III.1.1) bis III.1.3) der Bekanntmachung enthielten hinsichtlich der Auflistung und Beschreibung der Eignungskriterien jeweils einen Hyperlink, der unmittelbar auf das Formblatt 124 des VHB Bayern – Stand September 2022 in den Vergabeunterlagen verwies. Dieses Formblatt trug den Titel „Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen“ gefolgt von dem Klammerzusatz „vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind“. In dem Abschnitt „Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind“ des Formblatts fand sich auszugsweise folgende Angabe:
„Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum, vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.
[… ]
Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:
[…]“
Weiterer Bestandteil der Vergabeunterlagen war unter anderem das Formblatt 212EU mit der Bezeichnung „Teilnahmebedingungen EU“. Dieses enthielt unter Ziffer 7 mit dem Titel „Eignung“ unter anderem folgende Vorgabe:
„7.1 Offenes Verfahren
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
– entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
– oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
vorzulegen.
[…]“
Sowohl Antragstellerin als auch Beigeladene reichten innerhalb der auf den 05.10.2023, 09:00 Uhr, verlängerten Angebotsfrist ein Angebot ein. Ausweislich des Protokolls über die Submission am 05.10.2023 um 09:17 Uhr lag das Angebot der Beigeladenen mit einem preislichen Abstand von mehr als 35 % vor dem Angebot der Antragstellerin. Weitere Angebote lagen nicht vor.
Mit Schreiben vom 16.10.2023 wandte sich die Antragstellerin an den Antragsgegner und meldete zum Ergebnis der Angebotsöffnung Bedenken an. Die Beigeladene könne keine Elemente in Anlehnung an RC 4 mit S…-Hochsicherheitsschlössern herstellen, da sie keine RC 3- und RC 4-Prüfungen mit Hochsicherheitsschloss belegen könne. Die erforderliche Fachkompetenz stelle die Antragstellerin in Frage. Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit erscheine es notwendig, von den Bietern für RC 3-Türen mit Einfachverriegelung, RC 4-Türen sowie die Brandprüfungen von T 30- und T 90-Türen jeweils mit S…-Hochsicherheitsschlössern entsprechende Prüfzeugnisse zu fordern. Die Beigeladene könne weder Erfahrungen noch Referenzen zu JVA-Projekten vorweisen. Dagegen habe die Antragstellerin in den letzten Jahren zahlreiche Bauvorhaben im Bereich Justizvollzug durchgeführt. Zudem zweifle die Antragstellerin an, dass der Angebotspreis der Beigeladenen auskömmlich ist, dass die Beigeladene mit einem Mitarbeiterstamm von ca. 20 Mitarbeitern in der Lage ist, ein Bauvorhaben in dieser Größenordnung personell, technisch, organisatorisch und finanziell über die entsprechende Laufzeit abzuwickeln, sowie dass die Liquidität der Beigeladenen zur Absicherung des Leistungsteils des Bauvorhabens ausreichen werde.
Mit Schreiben vom 20.10.2023 antwortete der Antragsgegner der Antragstellerin, dass er von den Hinweisen Kenntnis genommen habe und im Rahmen der Prüfung und Wertung insbesondere auch die Eignung der Bieter genauestens geprüft werde.
Mit Informationsschreiben gemäß § 134 GWB vom 22.11.2023 setzte der Antragsgegner die Antragstellerin davon in Kenntnis, dass auf ihr Angebot nicht der Zuschlag erteilt werden könne, weil es nicht das wirtschaftlichste sei. Es liege ein niedrigeres Hauptangebot vor. Zudem teilte der Antragsgegner der Antragstellerin mit, dass beabsichtigt sei, den Zuschlag frühestens am 04.12.2023 auf das Angebot der Beigeladenen zu erteilen.
Mit Schreiben vom 23.11.2023 beanstandete die Antragstellerin die Vergabeentscheidung des Antragsgegners als vergaberechtswidrig. Die Beigeladene verfüge weder über die geforderte wirtschaftliche und finanzielle noch über die technische und berufliche Leistungsfähigkeit. Sie verfüge über keine Referenzen einer Leistungserbringung mit dem ausschreibungsgegenständlichen Umfang und einer Leistungserbringung mit S…-Hochsicherheitsschlössern. Außerdem verfüge die Beigeladene nicht über eine im Verhältnis zum Auftragsvolumen ausreichende Anzahl an Mitarbeitern. Zudem rügte die Antragstellerin, dass entgegen der Vorgabe in der Bekanntmachung offensichtlich nur der Preis zur Zuschlagsbewertung herangezogen worden sei.
Mit Schreiben vom 28.11.2023 antwortete der Antragsgegner der Antragstellerin, dass ihren Rügen nicht abgeholfen werde. Eine Prüfung der von der Beigeladenen vorgelegten Unterlagen habe ergeben, dass die geforderte Eignung des Bieters gegeben sei. Insbesondere verfüge die Beigeladene über geeignete Referenzen vergleichbarer Leistungen im vorgegebenen Zeitraum. Referenzen von Leistungserbringungen speziell mit S…-Hochsicherheitsschlössern seien im Vergabeverfahren nicht gefordert gewesen und somit nicht Bestandteil der Prüfung. Des Weiteren habe die Beigeladene schlüssig darstellen können, dass sie über geeignete personelle Kapazitäten verfügt. Zudem verwies der Antragsgegner darauf, dass dem Formblatt 211 EU unter Punkt 7 Angebotswertung eindeutig entnommen werden könne, dass als alleiniges Kriterium für die Wertung das Zuschlagskriterium Preis festgelegt sei. Die Bekanntmachung stehe dem nicht entgegen, da darin erläutert werde, dass alle Kriterien nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt sind.
Ebenfalls am 28.11.2023 reichte der Antragsgegner eine Schutzschrift bei der Vergabekammer Südbayern ein mit Ausführungen zur Unbegründetheit eines möglichen Nachprüfungsantrags der Antragstellerin, die im Wesentlichen den Darlegungen in der Rügeantwort entsprachen.
Mit Schreiben vom 30.11.2023 trat die Antragstellerin den Ausführungen des Antragsgegners in seiner Rügeerwiderung entgegen. Hauptbestandteil der Ausschreibung sei die Lieferung und der Einbau von Hochsicherheitstüren mit Hochsicherheitsschlössern. In diesem Sinne bedürfe es für die Angaben zu vergleichbaren Leistungen und damit zur Feststellung der Eignung entsprechender Angaben zu getätigten geprüften Einbauten von S…-Hochsicherheitsschlössern. Dass die Beigeladene derartige Angaben vornehmen könne, sei nicht bekannt. Zudem habe die Beigeladene Aufträge in diesem Umfang noch nicht ausgeführt. Nach Erfahrung der Antragstellerin bedürfe die Darlegung der Leistungsfähigkeit für den ausgeschriebenen Auftrag die Hinzunahme eines Nachunternehmers.
Nachdem den Rügen der Antragstellerin auch hiernach nicht abgeholfen wurde, stellte diese mit Schreiben vom 01.12.2023 einen Nachprüfungsantrag gem. § 160 Abs. 1 GWB.
Die Antragstellerin führt aus, dass der Nachprüfungsantrag zulässig sei. Insbesondere sei die Antragstellerin gemäß § 160 Abs. 2 GWB antragsbefugt. Mit Abgabe ihres Angebots habe sie ihr Interesse an der Ausschreibung und der Beauftragung bekundet. Die Antragstellerin sei in ihren Rechten verletzt, sollte der Zuschlag an einen nicht geeigneten Bieter erteilt werden. Die Antragstellerin sei Zweitbieterin mit Chance auf Erteilung des Zuschlages. Die Nichterteilung des Zuschlages wäre ein erheblicher Schaden.
Entgegen der Ansicht des Antragsgegners seien die Rügen weder ins Blaue hinein erfolgt noch seien sie präkludiert. Die Antragstellerin habe deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ihr als Marktteilnehmerin bekannt sei, dass die Beigeladene Aufträge in diesem Umfang noch nicht ausgeführt habe und sie derartige Angaben nicht habe vornehmen können. Hiermit seien tatsächliche Anknüpfungstatsachen vorgetragen worden, namentlich, dass die Beigeladene über keine Referenzen einer Leistungserbringung mit dem ausschreibungsgegenständlichen Umfang und einer Leistungserbringung mit S…-Hochsicherheitsschlössern verfüge sowie, dass die Beigeladene im Verhältnis zum Auftragsvolumen nicht über eine ausreichende Anzahl an Mitarbeitern verfüge. Dies umfasse auch die Unauskömmlichkeit des Preises und die nicht ausreichende Mitarbeiterzahl. Die Rügen resultierten aus der Marktkenntnis, dass die Beigeladene vergleichbare Projekte in dieser Größenordnung nicht erbracht habe. Zudem sei der Antragsgegner darauf hingewiesen worden, dass es nicht nur auf nicht geforderten Nach-weise, sondern auf die Erbringung vergleichbarer Leistungen (Referenzen) ankomme. Auf Basis der Rügen habe der Antragsgegner eine konkrete Prüfung vornehmen können; dies habe er auch getan und eine Schutzschrift erlassen.
Der Nachprüfungsantrag sei auch begründet, da die für den Zuschlag vorgesehene Bieterin für den ausgeschriebenen Auftrag nicht leistungsfähig und demnach nicht geeignet sei. Gemäß § 16b EU VOB/A sei die Eignung der Bieter zu prüfen. Welche Nachweise im Einzelfall von den Bietern vorzulegen sind, richte sich nach dem Inhalt der Bekanntmachung. Hier habe der Auftraggeber in der Bekanntmachung unter Ziff. III.2.3. auf das Formblatt 124 verwiesen. Darin habe der jeweilige Bieter die Möglichkeit, bis zu drei Referenzobjekte zu benennen. Gem. § 2 EU Abs. 3 VOB/A müssten Bieter die Kriterien Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Fachkundig sei ein Unternehmen, dass nicht nur notwendige, sondern umfassende betriebsbezogene Kenntnisse nach den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik auf dem jeweiligen Spezialgebiet habe, hier Hochsicherheitstüren mit S…-Hochsicherheitsschlössern herzustellen. Eine derartige Fachkenntnis und Prüfzeugnisfähigkeit habe die Beigeladene mit ihren Referenzen nicht nachgewiesen. Sie verfüge nicht über die spezielle objektbezogene Sachkenntnis des Einbaus von Hochsicherheitstüren und S…-Hochsicherheitsschlössern. Letztere seien Vorgaben aus der Ausschreibung. Mit der „Antwort zu Teilfrage 8“ der Bieterfragen habe die Antragstellerin auf die Verpflichtungen hingewiesen, die bei dem Einbau der S…-Hochsicherheitsschlösser einzuhalten sind und hierzu ausgeführt, dass Grundlage hierfür neben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der jeweiligen Rohrrahmentüre auch ein Prüfzeugnis für das Schloss des Fabrikats S… sei. Die Beigeladene habe entsprechende Einbauten noch nicht vorgenommen und entsprechende Prüfzeugnisse noch nie erhalten. Es lägen daher keine Angaben zu Leistungen vergleichbarer Art vor. Wenn wie vorliegend auf die Anforderung expliziter Eignungsnachweise verzichtet wird, müsse sich der Auftraggeber anderweitig von der fachlichen Eignung des zur Bezuschlagung vorgesehenen Bieters überzeugen. Dies umfasse mindestens die Überprüfung der Durchführung vergleichbarer Projekte.
Die Beigeladene sei zudem wirtschaftlich und finanziell für diesen Auftrag nicht leistungsfähig. Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des technischen und personellen Apparats sei die personelle Ausstattung von wesentlicher Bedeutung. Hierzu gehöre ein ausreichender Bestand an technischem und kaufmännischem Stammpersonal. Dieser Bestand betrage ausweislich der Auskunft der Creditreform 18 Mitarbeiter. Für die Abarbeitung eines Auftragsvolumens von 12 Mio. Euro sei dieser Bestand an Mitarbeitern nicht ausreichend. Die Beigeladene habe auch keine Nachunternehmer angegeben, die die Beigeladene fachlich unterstützen könnten. Soweit der Antragsgegner in der Antragserwiderung andeute, dass es möglich sei, dass die Beigeladene nach Zuschlagserteilung personell aufstocke, verkenne sie offensichtlich, dass für die Ausführung gerade der hier maßgeblichen Arbeiten im Bereich der Herstellung und Montage von Hochsicherheitstüren und dem Einbau von S…-Hochsicherheitsschlössern hochqualifiziertes, erfahrenes und geschultes Personal erforderlich sei, welches eine zertifizierbare Leistung zu erbringen habe, welches weder auf dem freien Markt verfügbar sei noch über Personaldienstleister kurzfristig hinzu gebucht werden könne.
Die Einsichtnahme in den Vergabevermerk habe die Rügen der Antragstellerin bestätigt, dass sich der Antragsgegner bei seiner Bewertung ausschließlich auf die Präqualifikationsangaben verlassen habe, ohne deren offensichtliche Inhalte für die Eignung der vorgesehenen Vergabe abzugleichen. Ausweislich des Vergabevermerks sei insbesondere nicht überprüft worden, ob seitens der Beigeladenen eine vergleichbare Leistung mit den maßgeblichen Anforderungen des ausgeschriebenen Auftrags durchgeführt wurde. Die Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen würden nach den eigenen Maßstäben des Antragsgegners mindestens die Leistungsteile „Verschluss der Hochsicherheitstüren“ sowie „sicherheitstechnisch relevanten Anteil“ umfassen und zwar in einer Form, dass sich der Antragsgegner hierauf vorbehaltlos verlassen kann. Letzteres ergebe sich aus dem Hinweis auf Seite 3 des Vergabevermerks, da nach eigenem Bekunden des Antragsgegners die verstärkte Schnittstellenprüfung- und Überwachung im Rahmen der beauftragten Ingenieurleistungen nicht kompensiert werden könne.
Der Antragsgegner habe sich ausschließlich auf die PQ-Eintragung bezogen, welche auch ein JVA-Projekt enthalte. Bei diesem Bauvorhaben, das der Antragstellerin bekannt sei, seien zwar vergleichbare Hochsicherheitstüren mit entsprechenden Hochsicherheits-Verschlussanlagen ausgeschrieben und gefordert gewesen. Die dafür erforderlichen Leistungen habe die Beigeladene jedoch komplett, also Lieferung einschließlich Montage, an einen Nachunternehmer vergeben. Die Beigeladene habe also für dieses JVA-Projekt im Bereich der Hochsicherheitstüren und -schlösser gerade keine eigenen Leistungen erbracht. Mit dem Bezug auf dieses JVA-Projekt könne die Beigeladene ihre technische Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die in der Ausschreibung geforderten Leistungen nicht belegen. Daneben sei zu beachten, dass Lieferung und Einbau der S…-Hochsicherheitsschlösser nur und ausschließlich in Zusammenarbeit mit dem Hersteller erfolgen könne. Die Beigeladene sei aber nicht als Kompetenzpartner des Herstellers gelistet, was erkennen lasse, dass sie gerade nicht mit der Firma zusammenarbeite. Jedenfalls habe der Antragsgegner es unterlassen, die Eignung dahingehend zu prüfen, ob es dem potentiellen Vertragspartner überhaupt möglich ist, die Leistungen zu erbringen.
Den Ausführungen auf Seite 3 des Vergabevermerks ließe sich entnehmen, dass der Antragsgegner erhöhte Anforderungen an die Ausführung stellte und zur Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen eine gewerkeübergreifende Leistungserbringung notwendig sei. Das schließe Bieter aus, die Leistungen nur als Nachunternehmer erbracht haben.
Soweit der Antragsgegner in Bezug auf die Angemessenheit des Angebotspreises der Beigeladenen auf seine eigene Budget-Schätzung abstelle, sei darauf zu erwidern, dass die Budget-Schätzung überholt sei und nicht die aktuelle Marktsituation abbilde. Wie sich aus dem Aktenvermerk ergebe, sei die Ausschreibung des hier in Rede stehenden Teilloses mit einem längeren zeitlichen Vorlauf erfolgt aufgrund der zunächst erfolgten und anschließend aufgehobenen Ausschreibung der Komplettleistungen. Aus dem Aktenvermerk ergebe sich zwar, dass eine Anpassung der Preise über den Baupreisindex II/2023 erfolgt sei. Dieser Index bilde jedoch die tatsächlichen Preisentwicklungen und Schwankungen gerade in dem hier in Rede stehenden Materialpreissektor nicht ab. Im Aktenvermerk werde auf Seite 4 sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund dieser besonderen Preisentwicklungen einige Positionen des Angebots der Beigeladenen nach wie vor sehr niedrig erscheinen würden. Zudem sei aus dem Aktenvermerk ersichtlich, dass der Antragsgegner den Preis vorrangig vor dem Hintergrund der Frage überprüft habe, ob aufgrund der Überschreitung der Kosten der HU-Bau eine erneute Aufhebung der Ausschreibung erforderlich sei. Offenbar seien nur einige wenige Positionen aufgeklärt worden.
Die Antragstellerin beantragt:
1. Der Antragsgegnerin zu untersagen, den Zuschlag auf das Angebot der Beigeladenen zu erteilen,
2. Festzustellen, dass die Antragstellerin in Ihren Rechten verletzt ist
3. Geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens wiederherzustellen und die Rechtsverletzung zu beseitigen,
4. Der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens einschließlich der zweckentsprechenden Kosten der Antragstellerin aufzuerlegen,
5. Die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten durch die Antragstellerin festzustellen,
6. Der Antragstellerin Akteneinsicht zu gewähren.
Der Antragsgegner beantragt:
1. Der Vergabenachprüfungsantrag vom 01.12.2023 der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der zum Zweck entsprechenden Rechtsverteidigung des Antragsgegners erforderlichen Aufwendungen zu tragen.
3. Die Hinzuziehung der Bevollmächtigten durch den Antragsgegner wird für erforderlich erklärt.
Der Antragsgegner führt aus, dass im streitgegenständlichen Verfahren die Eignungsanforderungen an die Bieter im Wege der Verlinkung auf die Eignungskriterien der Vergabe-unterlagen festgelegt worden seien. Der in Abschnitt III.1) der Bekanntmachung enthaltene Direktlink führe zum Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Danach seien für nicht präqualifizierte Bieter unter anderem Angaben über den Umsatz des Unternehmens, Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, sowie über die zur Verfügung stehenden für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte verlangt gewesen. Besondere Anforderungen oder Mindestbedingungen für die Eignung seien weder für einen Mindestumsatz noch für eine Mindestpersonalstärke und schließlich auch nicht für besondere Zertifizierungen oder besondere Leistungsinhalte in der Vergabebekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen benannt worden.
Die Beigeladene sei präqualifiziert. Die im PQ-Verzeichnis für die Beigeladene hinterlegten Referenzen umfassten unter anderem Leistungen in Bezug auf Brandschutz- und Sicherheitstüren mit automatischer Schließtechnik, Zutrittskontrolle und Sicherheitseinrichtungen für ein JVA Projekt. Ebenso seien mit der PQ-Eintragung die Eigenerklärung zum Personal und Eigenerklärungen zu Umsätzen in den Jahren 2019 bis 2021 dokumentiert. Die Vergabestelle habe das Angebot der Beigeladenen am 30.10.2023 aufgeklärt. Die Aufklärung habe verschiedene Aspekte des Angebots, etwa Erklärungen zum Inhalt des Angebots, die ergänzende Vorlage von Eignungsnachweisen und die Aufklärung von Einheitspreisen betroffen. Die Beigeladene habe auf das Aufklärungsverlangen innerhalb der von der Vergabestelle gesetzten Frist am 03.11.2023 geantwortet und die offenen Angaben und fehlenden Nachweise nachgereicht und aufgeklärt.
Der Nachprüfungsantrag sei unzulässig. Insbesondere seien die beanstandeten und behaupteten Vergaberechtsverstöße nicht hinreichend substantiiert und rechtzeitig gerügt worden. Soweit die Antragstellerin in ihrem Schreiben vom 16.10.2023 bloße Vermutungen äußere, würden keine konkreten Beanstandungen erhoben. Dies gelte namentlich für die Beanstandung der Unauskömmlichkeit des Preises, der nicht ausreichenden Mitarbeiteranzahl und der angezweifelten Liquidität der Beigeladenen. Bei der Bezugnahme auf eigene Marktkenntnisse, ohne entsprechenden weitergehenden Beleg hierzu, handle es sich um eine Rüge ins Blaue hinein, welche die inhaltlichen Mindestanforderungen an die Substantiierung einer Rüge nicht erfülle. Dies insbesondere auch deshalb, da nicht erwähnt werde, woraus die Antragstellerin ihre Erkenntnisse gewonnen haben will. Die Beanstandung, mit der bestimmte Zertifikate und Prüfzeugnisse als notwendig erachtet werden, richte sich gegen einen Verstoß, der auf einer unzulässigen Forderung zur (unterbliebenen) Verschärfung der Eignungsanforderungen basiere. Die Antragstellerin sei insoweit nicht antragsbefugt, da sie keinen Anspruch darauf habe, dass die Eignungsanforderungen verschärft werden. Soweit die Antragstellerin implizit die angebliche Notwendigkeit von Nachweisen durch Prüfzeugnisse zum Beleg der technischen Leistungsfähigkeit fordere, sei die Antragstellerin hiermit präkludiert, da diese Beanstandung gem. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 GWB bis zum Zeitpunkt des Ablaufs der (verlängerten) Angebotsfrist hätte erhoben werden müssen.
Gleiches gelte für die Rüge vom 23.11.2023, die keine weitergehenden Ausführungen enthalte, die den in den Bedenken vom 16.10.2023 vorgebrachten Aspekten einen Charakter verleihen könnten, welcher über bloße pauschale Vermutungen hinausgehe. Dass die Beanstandung zur fehlenden Eignung der Beigeladenen ins Blaue hinein erhoben wurde, ergebe sich auch daraus, dass die Antragstellerin die PQ-Listung der Beigeladenen, die durch eine einfache Internet-Recherche ermittelbar gewesen wäre, unberücksichtigt gelassen habe. Die mit der Rüge von 23.11.2023 ebenfalls erhobene Beanstandung, dass der Preis als einziges Zuschlagskriterium herangezogen worden sei und insoweit ein Widerspruch zwischen den Vergabeunterlagen und Auftragsbekanntmachung bestehe, sei gem. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB präkludiert, da sie nicht bis zum Ablauf der Angebotsfrist erhoben worden sei. Die im Schreiben vom 30.11.2023 einzig neue Beanstandung, für die Durchführung des Vertrags sei die Hinzunahme eines Nachunternehmers geboten, sei ebenfalls ins Blaue hinein erhoben worden und stelle eine bloße Vermutung dar.
Der Nachprüfungsantrag sei jedenfalls unbegründet. Die Eignung eines Bieters könne nur an den Kriterien gemessen werden, die der Auftraggeber in den Vergabeunterlagen genannt hat, oder die sich unter Berücksichtigung von Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen zwingend und für die Bieter transparent aus der Sache ergeben. Im vorliegenden Fall ergäben sich die Eignungsanforderungen aus der Vergabebekanntmachung und dem damit verlinkten Formblatt 124 der Vergabeunterlagen. Da die Beigeladene in die Liste der präqualifizierten Unternehmen eingetragen sei, sei sie von der Vorlage einzelner Nachweise zum Beleg ihrer Eignung befreit gewesen, soweit die mit der Präqualifikation vorliegenden Nachweise die Eignung belegen. Die mit der PQ-Eintragung verbundenen Nachweise der Beigeladenen enthielten unter anderem Referenzen, die in technischer Hinsicht vergleichbare Leistungen beträfen wie die vorliegend ausgeschriebenen Leistungen. Bei der Bewertung der Frage der Vergleichbarkeit von Referenzen billige die Rechtsprechung der Vergabestelle, welche regelmäßig über spezifisches Fachwissen und fachliche Erfahrungen verfüge, einen Beurteilungsspielraum zu, der nur eingeschränkt überprüft werden könne. Das Leistungsbild der herangezogenen Referenzaufträge müsse mit dem ausgeschriebenen Auftrag nicht identisch sein. Es reiche aus, dass die Referenzleistung der ausgeschriebenen Leistung soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet. Es wäre vergaberechtswidrig, die von der Antragstellerin behaupteten Maßstäbe zu Mindestanforderungen aufzustufen und an die Nichterfüllung die zwingende Rechtsfolge des Ausschlusses wegen fehlender Eignung zu knüpfen. Da zudem der Einbau der Hochsicherheitsschlösser von der Firma S… stets mit eigenem, von der Firma S… gestelltem Personal erfolge, werde der fachgerechte Einbau hinreichend gewährleistet.
Die Prüfung der technischen Eignung der Beigeladenen anhand der Titel im Leistungsverzeichnis könne wie folgt differenziert werden: Die technische Eignung für die gewerkeübergreifenden Leistungen wie Baustelleneinrichtung, Projektorganisation, etc. könne aus dem bewältigten Leistungsumfang des Referenzprojekts betreffend eine JVA-Anlage prognostiziert werden. Die technische Eignung zur Bewältigung der Anforderungen für die Pfosten-Riegel-Konstruktionen und Türen für alle Bauteile, Metallverkleidungen für Sockel und in der Fläche, teils mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (bis RC 4 und Brandschutz bis F90) bei den Aufsichtskabinen (inkl. Fenster in den Aufsichtskabinen) könne zumindest für die hauptsächlich maßgeblichen Verglasungen mit RC- und Brandschutz-Anforderungen aus den in den vorliegenden Referenzen bewältigten Anforderungen abgeleitet werden. Die technische Eignung für die Innenverglasungen, teils mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (bis RC 4, Brandschutz bis F90), könne zumindest für Verglasungen mit RC- und Brandschutz-Anforderungen aus den vorliegenden Referenzen abgeleitet werden; auch wenn in den Referenzen nicht direkt auf Innenverglasungen Bezug genommen werde, ähnele die technische Ausführung der Innenverglasung jedoch der Ausführung von Verglasungen in Türen. Die technische Eignung für die Rohrrahmentüren, teils mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (bis RC 4 und Brandschutz T90) könne für Rohrrahmentüren mit RC- und Brandschutz-Anforderungen ebenfalls aus den vorliegenden Referenzen abgeleitet werden. Gleiches gelte für die technische Eignung für die Außentüren, teils mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (bis und in Anlehnung an die Kategorie RC 4) für Außentüren mit RC- und Brandschutz-Anforderungen. Ein gesonderter technischer Eignungsnachweis für die einzubauenden Hochsicherheitsschlösser des Herstellers S… habe nicht geprüft werden müssen, da insoweit eine reine Zukaufleistung nach der Produktvorgabe des Antragsgegners erfolge. Damit sei die Prognose gerechtfertigt gewesen, dass die Beigeladene im Fall ihrer Beauftragung einen ordnungsgemäßen Vertragsvollzug erwarten lasse. Dass die Leistungen der Referenz betreffend die Justizvollzugsanstalt von der Beigeladenen im Hinblick auf Lieferung und Montage an einen Nachunternehmer vergeben worden seien, werde bestritten. Der Inhalt der Referenz spreche ausdrücklich davon, dass die Leistungen aus der im eigenen Betrieb erbrachten Fertigung der verschiedenen Sicherheitstüren bestanden hätten, und dass Planung, Fertigung und Montage der entsprechenden Stahlglastürelemente mit eigenem Führungspersonal bearbeitet worden sei.
Die Beigeladene sei ferner wirtschaftlich und finanziell für den Auftrag leistungsfähig. Die Vergabestelle habe die Beigeladene mit Schreiben vom 30.10.2023 zur Nachreichung auch von Eignungsnachweisen über die Umsatzangaben und die für die Leistung erforderlichen Arbeitskräfte aufgefordert. Die Beigeladene habe hierzu inhaltlich Stellung genommen und ihre Leistungsfähigkeit plausibel erläutert.
Letztlich habe die Beigeladene auch ihre Angaben zum Nachunternehmereinsatz sowie ihre Kalkulation zu den vom Antragsgegner als aufklärungsbedürftig angesehenen Einheitspreisen erläutert. Die aufgeklärten Positionen hätten dabei Leistungsvorgaben betroffen, bei denen in der Regel mit umfangreichen Nachtragspotenzialen gerechnet werden könne bzw. die am Anfang der Maßnahme zur Erzielung von Liquidität in Abschlagsrechnungen einbezogen würden. Da der Gesamtpreis aus dem Angebot der Beigeladenen oberhalb der geschätzten Kosten für den Auftragswert liege, sei ein unangemessen niedriges Angebot auszuschließen. Die Schätzung des Auftragswerts sei anhand einer methodisch zutreffenden Berechnung auf der Basis von hinreichend vergleichbaren Ansätzen vorgenommen worden und könne damit als hinreichende Grundlage für die Beurteilung einer Preisprüfung angesetzt werden. Da der Gesamtangebotspreis der Beigeladenen die Auftragswertschätzung überschritten habe, sei allein darüber zu entscheiden gewesen, ob das Vergabeverfahren aufzuheben war. Die Vergabestelle sei nach Prüfung zu der Einschätzung gelangt, dass trotz der Überschreitung der Kostenberechnung eine (erneute) Aufhebung nicht erfolgen soll, und habe dabei unter anderem berücksichtigt, dass sich das Angebot der Beigeladenen mit dem Angebotspreis innerhalb des für das betroffene Vergabepaket veranschlagten Budgets befinde.
Mit Beschluss vom 07.12.2023 wurde die Zuschlagsprätendentin zum Verfahren beigeladen.
Die Beigeladene stellt keine Anträge. Zur Sache führt sie aus, dass die Behauptung der Antragstellerin, sie hätte hinsichtlich der JVA-Referenz die Lieferung einschließlich Montage der Hochsicherheitstüren mit entsprechenden Hochsicherheits-Verschlussanlagen an ein Nachunternehmen vergeben und für dieses Projekt im Bereich der Hochsicherheitstüren und Schlösser keine eigenen Leistungen erbracht, nicht zutreffe. Von den Sicherheitstüren mit S…-Hochsicherheitsschlössern sei lediglich ein kleiner Teil von einem Nachunternehmer gefertigt und montiert worden. Der überwiegende Anteil der Sicherheitstüren mit S…- Hochsicherheitsschlössern sei von ihr vollständig in Eigenleistung gefertigt und im Objekt montiert worden. Entgegen der Behauptung der Antragstellerin sei die Beigeladene auch Kompetenzpartner des Herstellers.
Am 25.01.2024 fand in den Räumen der Regierung von Oberbayern die mündliche Verhandlung statt. Die Sach- und Rechtslage wurde erörtert. Die Verfahrensbeteiligten hatten Gelegenheit zum Vortrag. Die Vergabekammer wies die Beteiligten darauf hin, dass das Angebot der Beigeladenen ungeachtet ihrer in Frage stehenden Eignung nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden könne, da die Gestaltung der Angebotsunterlagen (Formblätter 124 und 212) die Bieter dazu verleitet habe, zum Nachweis ihrer Eignung keine vergleichbaren Referenzen vorzulegen, sondern auf die im Präqualifizierungsverzeichnis hinterlegten Referenzen zu verweisen. Offenbar verfügten allerdings sowohl die Beigeladene, die mittlerweile neue Referenzen im Präqualifizierungsverzeichnis hinterlegt habe, als auch die Antragstellerin über weitere, möglicherweise vergleichbare Referenzen, die sie allerdings nicht zum Nachweis ihrer Eignung vorgelegt hätten. Aufgrund dieser Sachlage sei nach vorläufiger Rechtsauffassung der Vergabekammer eine Zurückversetzung bis vor die Bekanntmachung und die Klarstellung der geforderten Nachweise erforderlich.
Mit Schriftsatz vom 05.02.2024 teilte der Antragsgegner zur Kenntnis der Vergabekammer mit, dass er die Teilnehmer an dem verfahrensgegenständlichen Vergabeverfahren durch Mitteilung über die Vergabeplattform darüber informiert habe, dass das Verfahren in den Stand vor Bekanntmachung zurückversetzt worden sei. Die Zurückversetzung beruhe auf dem sachlichen Grund, dass mit der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf eine bloße Prüfung der PQ-Eintragungen von der Vergabestelle entgegen der Vorgabe des verlinkten Formblatts 124 nicht zur alleinigen Maßgabe für die Eignungsprüfung habe gemacht werden können. Die in der Bekanntmachung anzugebenden Eignungsanforderungen seien daher so zu fassen, dass die Eignung anhand der tatsächlich für die Bewältigung des ausgeschriebenen Vorhabens anzugebenden Belege geprüft werden könne. Die Zurückversetzung sei darüber hinaus auch recht-mäßig, da kein Angebot vorliege, dass den Ausschreibungsbedingungen entspreche. Zugleich lägen andere schwerwiegende Gründe vor, die einer Zuschlagsentscheidung entgegenstünden.
Mit Schriftsätzen vom 06.02.2024 und 08.02.2024 beantragte die Antragstellerin die Aufhebung der Rückversetzung des Ausschreibungsverfahrens vor Bekanntmachung. Hilfsweise beantragte sie festzustellen, dass eine Rechtsverletzung vorliegt. Zur Begründung führte die Antragstellerin aus, dass die Antragstellerin durch ein Rückversetzen in den Stand vor der Bekanntmachung in ihrer Chance auf Zuschlagserteilung verletzt sei und keine Gründe für eine Rückversetzung vorlägen. Der Wettbewerb sei nicht durch die Bekanntmachung, sondern durch die fehlende Prüfung der Eignung beeinträchtigt. Durch eine erneute Bekanntmachung oder eine Konkretisierung der Eignungsanforderungen ändere sich der Bieterkreis nicht. Es seien auch keine Gründe für die Rückversetzung des Vergabeverfahrens dokumentiert worden. Der pauschale Bezug auf die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf sei nicht nachvollziehbar und daher nicht ausreichend. Die Antragstellerin sei geeignet und habe ihre Eignung vergaberechtskonform dargestellt. Sie sei nicht von dem Ausschreibungsverfahren auszuschließen. Die Eignung der Antragstellerin sei vom Antragsgegner bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch nicht abgefragt oder gar geprüft worden. Das Angebot der Antragstellerin sei auch nicht unangemessen hoch. Die Kostenschätzung des Auftraggebers sei unvollständig. Sie berücksichtige nicht die Preisentwicklung der letzten Zeit und sie berücksichtige nicht die Anforderungen, die an die Leistungserbringung gestellt würden. Am Markt ließen sich für die ausgeschriebene Leistung keine anderen Preise erzielen. Jedenfalls habe der Antragsgegner die Kosten des Verfahrens zu tragen, da er eine anderweitige Konkretisierung der Eignungsanforderungen vornehmen wolle.
Mit Schriftsatz vom 09.02.2024 beantragte der Antragsgegner, den Antrag auf Aufhebung der Rückversetzung des Ausschreibungsverfahrens vor Bekanntmachung und den Antrag auf Feststellung der Rechtsverletzung kostenpflichtig zurückzuweisen. Die Zurückversetzung diene dazu, den Bedenken der Vergabekammer an einer hinreichenden Vorgabe der Eignungsanforderungen zu begegnen und zu diesem Zweck die Eignungsnachweise nach § 122 Abs. 4 Satz 2 GWB neu zu fassen und bekannt zu machen. Eine Diskriminierung der Antragstellerin sei damit nicht verbunden. Die Antragstellerin habe (wie die anderen Bieter auch) keinen Anspruch auf Zuschlagserteilung. Die Zurückversetzung sei auch rechtmäßig. Substantielle Einwendungen gegen die Berufung auf § 16d EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A habe die Antragstellerin nicht erhoben.
Die Beteiligten wurden durch den Austausch der jeweiligen Schriftsätze informiert. Auf die ausgetauschten Schriftsätze, die Verfahrensakte der Vergabekammer, die Niederschrift der mündlichen Verhandlung sowie auf die Vergabeakten, soweit sie der Vergabekammer vorgelegt wurden, wird ergänzend Bezug genommen.
II.
Die Vergabekammer Südbayern ist für die Überprüfung des streitgegenständlichen Vergabeverfahrens zuständig.
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Vergabekammer Südbayern ergibt sich aus §§ 155, 156 Abs. 1, 158 Abs. 2 GWB i. V. m. §§ 1 und 2 BayNpV.
Durch die Zurückversetzung des streitgegenständlichen Vergabeverfahrens in den Stand vor der Auftragsbekanntmachung hat sich das Nachprüfungsverfahren in der Hauptsache erledigt.
1. Die Zurückversetzung ist wirksam, da sie zur Klarstellung der Eignungsanforderungen notwendig und damit sachlich gerechtfertigt ist. Der auf die Aufhebung der Rückversetzung gerichtete Antrag der Antragstellerin war deshalb zurückzuweisen.
1.1. Die Zurückversetzung stellt eine teilweise Aufhebung des Vergabeverfahrens dar und richtet sich dementsprechend nach den Regelungen über die Aufhebung (vgl. VK Südbayern, Beschluss vom 05.10.2016 – Z3-3-3194-1-33-08/16). Bei der rechtlichen Überprüfung der vollständigen oder auch nur teilweisen Aufhebung eines Vergabeverfahrens ist zwischen der Wirksamkeit und der Rechtmäßigkeit der (Teil-) Aufhebungsentscheidung öffentlicher Auftraggeber zu unterscheiden. Ein öffentlicher Auftraggeber kann grundsätzlich nicht verpflichtet werden, einen Auftrag auf der Grundlage einer Ausschreibung zu erteilen, die einen erheblichen Fehler im Vergabeverfahren aufweist (vgl. VK Bund, Beschluss vom 13.02.2020 – VK 1-02/20). Dies ist Folge der Vertragsfreiheit, die auch für im Wege öffentlicher Ausschreibungen vergebene Aufträge gilt. Notwendige Voraussetzung für eine vollständige oder auch nur teilweise Aufhebung einer Ausschreibung ist lediglich, dass der öffentliche Auftraggeber für seine (Teil-) Aufhebungsentscheidung einen sachlichen Grund hat, so dass eine Diskriminierung einzelner Bieter ausgeschlossen und seine Entscheidung nicht willkürlich ist oder nur zum Schein erfolgt (VK Südbayern, Beschluss vom 6.9.2018 – Z3-3-3194-1-24-07/18; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12.1.2015 – VII Verg 29/14).
1.2. Ein solch sachlicher Grund ist vorliegend gegeben. Wie die Vergabekammer bereits im Rahmen der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, war in streitgegenständlichem Vergabe-verfahren unklar, ob und welche Nachweise präqualifizierte Bieter zum Beleg ihrer technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit einzureichen hatten.
Vorliegend hatte der Antragsgegner hinsichtlich der Kriterien der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit in Abschnitt III.1.3) der Auftragsbekanntmachung einen Link auf das Formblatt 124 des VHB Bayern – Stand September 2022 eingefügt. Die Praxis, Eignungsanforderungen mittels eines Direkt-Links auf ein Dokument der Vergabeunterlagen bekannt-zugeben, aus dem sich die Eignungsanforderungen ergeben, erachtet die vergaberechtliche Rechtsprechung grundsätzlich als zulässig (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 08.06.2022 – VII Verg 19/22; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 11.07.2018 – VII Verg 24/18). Allerdings besteht vorliegend die Besonderheit, dass sich das verlinkte Formblatt ausweislich seines Titels nur auf nicht präqualifizierte Unternehmen bezieht. Laut des darauffolgenden Klammerzusatzes ist es vom Bieter nur auszufüllen, soweit dieser nicht präqualifiziert ist. Es stellt sich damit die Frage, welche Eignungsanforderungen Bieter zu erfüllen hatten, die eine einschlägige Präqualifikation aufweisen.
1.2.1. Nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf müssen die inhaltlichen Anforderungen an die Eignung und ihre Nachweise für jeden Bieter gleich sein, unabhängig davon, ob dieser präqualifiziert ist oder nicht (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 08.06.2022 – VII Verg 19/22). Der in § 122 Abs. 3 GWB, § 6b EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A-EU geregelte Nachweis der Eignung durch Teilnahme an einem Präqualifikationssystem diene der Umsetzung von Art. 64 der Vergaberichtlinie 2014/24/EU. Der Bestimmung liege die Erwägung zugrunde, den Verwaltungsaufwand zu verringern, welcher insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen durch die Führung des Eignungsnachweises entstehe. Die Teilnahme am Präqualifikationssystem bezwecke demnach eine Entlastung des Bieters von der Beibringung der Eignungsnachweise, nicht jedoch ihrer Ersetzung. Die Erleichterung in Bezug auf die Beibringung ändere nichts daran, dass die Erfüllung der Eignungskriterien grundsätzlich vom Bieter nachzuweisen sei. Dies gelte auch für einen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragenen Bieter. Dieser sei nur insoweit privilegiert, als er von der Beibringung der geforderten Eignungsnachweise entlastet und die inhaltliche Richtigkeit der hinterlegten Nachweise vermutet würde. Die inhaltlichen Anforderungen an die Eignungsnachweise gälten aber auch für ihn, da nur so das der Konkretisierung des Gleichbehandlungsgrundsatzes dienende Eignungserfordernis gemäß § 122 Abs. 1 GWB gewährleistet sei, wonach Aufträge nur an fachkundige und leistungsfähige Unternehmen vergeben werden (zu alledem OLG Düsseldorf, aaO).
Die Vergabekammer erachtet diese Argumentation für stichhaltig. Wie sich aus Art. 64 Abs. 6 Unterabs.1 Satz 1 der Richtlinie 2014/24/EU ergibt, müssen die Nachweisanforderungen für die Eignungskriterien, auf die sich die Wirtschaftsteilnehmer für ihre Eintragung in das amtliche Verzeichnis berufen, unter anderem die Anforderungen des Art. 60 der Richtlinie erfüllen. Aus diesem Verweis in der Regelung über amtliche Verzeichnisse zugelassener Wirtschaftsteilnehmer auf die außerhalb dieser Verzeichnisse zu erbringenden Nachweise an die Eignung ergibt sich zur Überzeugung der Vergabekammer, dass der EU-Gesetzgeber präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter im Hinblick auf die jeweils zu erbringenden Eignungsnachweise grundsätzlich gleichbehandelt wissen wollte.
1.2.2. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob präqualifizierte Bieter im vorliegenden Fall dem über die Auftragsbekanntmachung verlinkten Formblatt zur Eigenerklärung der Eignung mit der gebotenen Eindeutigkeit entnehmen konnten, dass die in dem Formblatt enthaltenen Nachweisanforderungen auch für sie Anwendung finden sollten.
Der Erklärungswert der Vergabeunterlagen beurteilt sich nach den für die Auslegung von Willenserklärungen maßgeblichen Grundsätzen der §§ 133, 157 BGB (BGH, Beschluss vom 07.01.2014 – X ZB 15/13). Dabei ist auf die objektive Sicht eines verständigen und fachkundigen Bieters abzustellen, der mit der Erbringung der ausgeschriebenen Leistung vertraut ist (OLG München, Beschluss vom 20.01.2020 – Verg 19/19). Maßgeblich ist nicht das Verständnis eines einzelnen Bieters, sondern wie der abstrakt angesprochene Empfängerkreis die Leistungsbeschreibung und Vergabeunterlagen versteht (OLG München, aaO). Wie Mitbieter die Vergabeunterlagen verstanden haben, kann für die normativ zu bestimmende Verständnismöglichkeit des durchschnittlichen Bieters von indizieller Bedeutung sein (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.2017 – VII-Verg 19/17). Kommen nach einer Auslegung von Vergabeunterlagen mehrere Verständnismöglichkeiten in Betracht oder können Unklarheiten oder Widersprüche nicht aufgelöst werden, geht dies zulasten des öffentlichen Auftraggebers (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.2017 – VII-Verg 19/17). Die Vergabestellen trifft insoweit die Verpflichtung, die Vergabeunterlagen klar und eindeutig zu formulieren und Widersprüchlichkeiten zu vermeiden (OLG München, Beschluss vom 09.03.2020 – Verg 27/19 m. w. N.).
Im Zweifel dürfen Bieter die Vergabeunterlagen so verstehen, dass sie den vergaberechtlichen Anforderungen entsprechen, denn das Verständnis des durchschnittlich erfahrenen Bieters basiert auf der Annahme, dass sich die Vergabestelle vergaberechtskonform verhält (vgl. OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 28.09.2023 – 11 Verg 2/23). Dies spricht dafür, dass präqualifizierte Bieter davon ausgehen konnten, dass ihre technische und berufliche Leistungs-fähigkeit ebenso wie bei nicht präqualifizierten Bietern an dem im Formblatt 124 niedergelegten Maßstab gemessen würde. Ungeachtet dessen entsprach es allerdings zumindest bis zu dem klarstellenden Beschluss des OLG Düsseldorf zur notwendigen Gleichbehandlung von präqualifizierten und nicht präqualifizierten Bietern bezüglich des Nachweises ihrer Eignung in weiten Teilen der vergaberechtlichen Praxis öffentlicher Auftraggeber, bei präqualifizierten Bietern den Nachweis ihrer Eintragung in das Präqualifikationsverzeichnis als hinreichenden Nachweis ihrer Eignung genügen zu lassen. Diese weitverbreitete frühere, aber teilweise auch heute noch anzutreffende, Praxis kann nach Ansicht der Vergabekammer bei der Ermittlung des Verständnisses durchschnittlich erfahrener und mit Vergabeverfahren vertrauter Bieter nicht unberücksichtigt bleiben. Dass Bieter auch heute noch der Vorstellung erliegen, ihre Eintragung in das Präqualifikationsverzeichnis genüge als Nachweis ihrer Eignung, zeigt sich am Verhalten der Beigeladenen im vorliegenden Fall, die davon absah, vor Angebotsabgabe die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzen mit Blick auf den streitgegenständlichen Auftrag zu ergänzen, obwohl ihr das – wie sich im Nachhinein gezeigt hat – möglich gewesen wäre. Hinzu kommt, dass sich auch die Vorgabe unter Ziffer 7.1. der Teilnahmebedingungen gemäß Formblatt 212 EU in diesem Sinne verstehen lässt. Danach führen präqualifizierte Unternehmen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag ins Präqualifikationsverzeichnis und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Demgegenüber haben nicht präqualifizierte Unternehmen mit dem Angebot entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. Diese Regelungssystematik, nach welcher der Nachweis der Eignung sowohl bei präqualifizierten Bietern als auch bei nicht präqualifizierten Bietern jeweils unter dem Vorbehalt gegebenenfalls geforderter auftragsspezifischer Einzelnachweise steht, lässt sich durchaus so verstehen, dass der Eintrag in das Präqualifikationsverzeichnis der ausgefüllten Eigenerklärung zur Eignung gleichgestellt sein sollte. Dies gilt jedenfalls in Fällen wie dem vorliegenden, wo der Auftraggeber neben dem Eintrag in das Präqualifikationsverzeichnis oder der ausgefüllten Eigenerklärung zur Eignung keine auftragsspezifischen Einzelnachweise gefordert hat.
Erschwerend für ein eindeutiges Verständnis der Vorgaben der Vergabeunterlagen im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass gänzlich unklar war, welche Leistungsbereiche die Präqualifikation eines Bieters umfassen musste und wie sich die Nachweisführung in jenen Fällen gestalten sollte, in denen ein Bieter nur für einen Teil der einschlägigen Leistungsbereiche präqualifiziert ist. Auch diese Unklarheit geht zulasten des öffentlichen Auftraggebers. Hätte der Antragsgegner also das Vergabeverfahren nicht von sich aus in den Stand vor der Auftragsbekanntmachung zurückversetzt, wäre er hierzu von der Vergabekammer zur Klarstellung der zu erfüllenden Eignungsanforderungen zu verpflichten gewesen, da gemäß § 122 Abs. 4 Satz 2 GWB die Eignungskriterien bereits in der Auftragsbekanntmachung anzugeben sind. Damit besteht aber im Ergebnis kein Zweifel, dass die Zurückversetzung des Vergabeverfahrens durch den Antragsgegner von einem sachlichen Grund getragen und damit wirksam ist.
2. Die wirksame Zurückversetzung des Vergabeverfahrens in den Stand vor der Auftragsbekanntmachung führt zu einer Erledigung des Nachprüfungsantrags, da ihm insoweit die Grundlage entzogen wurde.
Die Erledigung des Nachprüfungsantrags hat zur Folge, dass das Verfahren einzustellen und nur noch über den hilfsweise gestellten Feststellungsantrag der Antragstellerin sowie die Kosten zu entscheiden ist.
2.1. Der Hilfsantrag der Antragstellerin festzustellen, dass eine Rechtsverletzung vorliegt, ist unzulässig.
2.1.1. Die Vergabekammer geht davon aus, dass die Antragstellerin mit ihrem Hilfsantrag eine Feststellung der Rechtswidrigkeit der Zurückversetzung des Vergabeverfahrens begehrt und nicht eine Feststellung nach § 168 Abs. 2 Satz 2 GWB im Hinblick auf die ursprünglich geltend gemachten Rechtsverletzungen. Die für die Auslegung von Willenserklärungen des bürgerlichen Rechts entwickelten Grundsätze sind auf die Auslegung von Prozesserklärungen entsprechend anwendbar (vgl. BGH, Beschluss vom 14.02.2001 – XII ZB 192/99). Dies gilt auch für Erklärungen im Vergabenachprüfungsverfahren (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 08.11.2012 – 13 Verg 7/12). Die Auslegung orientiert sich an dem Grundsatz, dass im Zweifel dasjenige gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage der Prozesspartei entspricht (BGH, Beschluss vom 08.09.2021 –VIII ZR 258/20).
In der Begründung zu ihrem hilfsweise gestellten Feststellungsantrag geht die Antragstellerin auf die ursprünglich geltend gemachten Rechtsverletzungen, insbesondere den nicht erfolgten Ausschluss der Beigeladenen mangels Eignung, nicht mehr ein. Sie konzentriert ihre Argumentation vielmehr darauf, dass die Rückversetzung unwirksam und rechtswidrig sei, da es keinen Grund zur Rückversetzung des Vergabeverfahrens in den Stand vor Bekanntmachung gebe. Der Antragsgegner sei verpflichtet, eine Eignungsprüfung vorzunehmen, nötigenfalls unter Nachforderung fehlender, unvollständiger oder fehlerhafter unternehmensbezogener Unter-lagen. Eine grundlegende Änderung der Vergabeunterlagen sei nicht erforderlich und das Angebot der Antragstellerin auch nicht unangemessen hoch. Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen, die auf eine Rechtsverletzung der Antragstellerin durch die Zurückversetzung des Vergabeverfahrens gerichtet sind, geht die Vergabekammer davon aus, dass es der wohlverstandenen Interessenlage der Antragstellerin entspricht, eine Feststellung der Rechtswidrigkeit der Zurückversetzung des Vergabeverfahrens zu erlangen. Ein solcher Antrag ist in entsprechender Anwendung des § 168 Abs. 2 Satz 2 GWB statthaft (vgl. BGH, Beschluss vom 20.03.2014 – X ZB 18/13).
2.1.2. Der hilfsweise gestellte Feststellungsantrag der Antragstellerin ist jedoch mangels Darlegung ihres Feststellungsinteresses unzulässig.
Wie jeder Feststellungsantrag setzt auch der Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Aufhebung bzw. Zurückversetzung des Vergabeverfahrens als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal die Darlegung eines konkreten Feststellungsinteresses voraus (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 19.03.2019 – 13 Verg 1/19; VK Südbayern, Beschluss vom 12.12.2022 – 3194.Z3-3_01-22-33). Dies ergibt sich bereits aus den allgemeinen prozessualen Grundsätzen, nach denen die Inanspruchnahme eines Gerichts bzw. der Vergabekammer nicht zulässig ist, wenn kein berechtigtes Interesse vorliegt. Zur Bestimmung eines solchen Feststellungsinteresses kann auf die Grundsätze anderer Verfahrensordnungen, insbesondere zur Fortsetzungsfeststellungsklage nach der Verwaltungsgerichtsordnung zurückgegriffen werden (VK Hessen, Beschluss vom 31.07.2002 – 69d-VK-14/2002; VK Schleswig-Holstein, Beschluss vom 25.01.2012 – VK -SH 24/11).
Ein Feststellungsinteresse rechtfertigt sich durch jedes nach vernünftigen Erwägungen und nach Lage des Falles anzuerkennende Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art, wobei die beantragte Feststellung geeignet sein muss, die Rechtsposition des Antragstellers in einem der genannten Bereiche zu verbessern und eine Beeinträchtigung seiner Rechte auszugleichen oder wenigstens zu mildern. Das Feststellungsinteresse ist explizit zu begründen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25.10.2023 – Verg 18/23 m. w. N.).
Ausgehend von diesen Maßstäben kann die Vergabekammer ein besonderes Feststellungsinteresse der Antragstellerin an einer Feststellung der Rechtswidrigkeit der Zurückversetzung des Vergabeverfahrens nicht erkennen. Die Antragstellerin hat nichts zur Begründung eines besonderen Feststellungsinteresses vorgetragen. Auch ein Feststellungsinteresse wegen möglicher Schadensersatzansprüche kann nicht allein aufgrund der im Schadensersatzprozess geltenden Bindungswirkung der Entscheidung der Vergabekammer und des Beschwerdegerichts gemäß § 179 GWB ohne nähere Angaben zu den behaupteten Ansprüchen angenommen werden (OLG Düsseldorf, a.a.O.). Bei fortbestehendem Beschaffungsbedarf des Antragsgegners ist zu erwarten, dass das Vergabeverfahren nach einer Konkretisierung der Eignungsanforderungen fortgesetzt wird. Die Antragstellerin wird in diesem Fall erneut Gelegenheit haben, ihr Angebot einzureichen. Denkbar sind in dieser Situation allenfalls geringfügige Schadensersatzansprüche auf das negative Interesse wegen der Erstellung ihres ersten Angebots. Die Antragstellerin hätte hierzu aber darzulegen, dass sie bei ordnungs-gemäßer Durchführung des Vergabeverfahrens den Zuschlag erhalten hätte, was angesichts ihrer zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe im PQ-Verzeichnis hinterlegten Eignungsnachweise zweifelhaft ist, oder welche sonstigen Schäden ihr entstanden sind (vgl. BGH, Urteil vom 20.11.2012 – X ZR 108/10; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.08.2019 – Verg 9/19).
2.2. Nach § 182 Abs. 3 S. 4, 5 GWB treffen Antragstellerin und Antragsgegner aus Gründen der Billigkeit die Kostenlast zu gleichen Teilen. Zwar hat der Antragsgegner dem Nachprüfungsantrag durch die Zurückversetzung des Vergabeverfahrens in den Stand vor der Auftragsbekanntmachung die Grundlage entzogen und ist damit einer entsprechenden Verpflichtung durch die Vergabekammer zuvorgekommen, was für eine Kostentragung des Antragsgegners spricht (vgl. VK Südbayern, Beschluss vom 20.04.2018 – Z3-3-3194-1-59-12/17). Gleichwohl ist hier zu berücksichtigen, dass die Antragstellerin mit ihrem Recht-schutzbegehren, die Zurückversetzung des Vergabeverfahrens rückgängig zu machen bzw. hilfsweise festzustellen, dass diese rechtswidrig ist, nicht durchdringen konnte. In dieser Situation entspricht es nach Ansicht der Vergabekammer billigem Ermessen, Antragstellerin und Antragsgegner die Kostenlast zu gleichen Teilen aufzuerlegen.
Die Gebührenfestsetzung beruht auf § 182 Abs. 2 GWB. Diese Vorschrift bestimmt einen Gebührenrahmen zwischen 2.500 Euro und 50.000 Euro, der aus Gründen der Billigkeit auf ein Zehntel der Gebühr ermäßigt und, wenn der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung außergewöhnlich hoch sind, bis zu einem Betrag von 100.000 Euro erhöht werden kann. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand der Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des Gegenstands des Nachprüfungsverfahrens. Eine Reduzierung der Gebühr auf die Hälfte nach § 182 Abs. 3 S. 4 GWB scheidet vorliegend aus, da die Vergabekammer streitig über die Erledigung des Nachprüfungsantrags befinden musste.
Der Antragsgegner ist als Bundesland von der Zahlung der Gebühr nach § 182 Abs. 1 S. 2 GWB i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 2 VwKostG (Bund) vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) in der am 14. August 2013 geltenden Fassung befreit. Von der Antragstellerin wurde bei Einleitung des Verfahrens ein Kostenvorschuss in Höhe von 2.500 Euro erhoben. Dieser Kostenvorschuss wird nach Bestandskraft verrechnet.
Die Entscheidung über die Tragung der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen von Antragstellerin und Antragsgegner beruht auf § 182 Abs. 4 S. 3 1. HS GWB. Aufgrund der vorgenommenen Kostenteilung zwischen Antragsgegner und Antragstellerin entspricht es billigem Ermessen, dass die Beteiligten ihre Aufwendungen selbst zu tragen haben und eine Erstattung nicht stattfindet (vgl. OLG Naumburg, Beschluss vom 23.12.2014 – 2 Verg 5/14).
Auch wenn die Beigeladene keine Anträge gestellt hat, muss die Vergabekammer von Amts wegen über die Aufwendungen der Beigeladenen entscheiden.
Die Entscheidung über die Tragung der zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Beigeladenen folgt aus § 182 Abs. 4 S. 3, S. 2 GWB. Danach sind Aufwendungen der Beigeladenen nur erstattungsfähig, wenn die Vergabekammer sie als billig erachtet. Dabei setzt die Erstattungsfähigkeit jedenfalls voraus, dass die Beigeladene sich mit demselben Rechtsschutzziel wie der obsiegende Verfahrensbeteiligte aktiv am Nachprüfungsverfahren beteiligt hat (OLG Brandenburg, Beschl. v. 09.02.2010, Az.: Verg W 10/09). Dieser für die kostenrechtliche Berücksichtigung der Beigeladenen maßgebende Grundsatz ist auch bei der Kostenentscheidung nach Erledigung des Nachprüfungsantrags von entscheidender Bedeutung (OLG Celle, Beschl. v. 29.06.2010, Az.: 13 Verg 4/10).
Die Beigeladene hat sich nur punktuell durch schriftsätzlichen Vortrag geäußert, jedoch keine Anträge gestellt und sich insoweit auch nicht aktiv am Verfahren beteiligt. Sie trägt ihre Aufwendungen selbst.
Rechtsmittelbelehrung
…
München, 27.02.2024