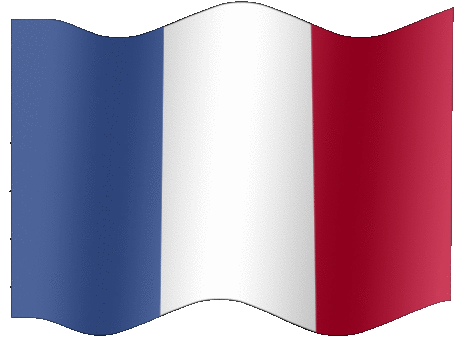OLG Schleswig zu der Frage, dass der Auftragnehmer eine kalkulatorisch unklare Leistungsbeschreibung nicht einfach hinnehmen darf, sondern sich daraus ergebende Zweifelsfragen vor Angebotsabgabe klären muss
vorgestellt von Thomas Ax
1. Der Auftragnehmer darf eine kalkulatorisch unklare Leistungsbeschreibung nicht einfach hinnehmen, sondern muss sich daraus ergebende Zweifelsfragen vor Angebotsabgabe klären. Das gilt insbesondere dann, wenn sich für ihn aus der Leistungsbeschreibung die Bauausführung in bestimmter Weise nicht mit hinreichender Klarheit ergibt, er darauf aber bei der Kalkulation maßgebend abstellen will (Anschluss an BGH, Urteil vom 25.06.1987 – VII ZR 107/86, IBRRS 1987, 0611).
2. Reichen die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen für eine zuverlässige Kalkulation nicht aus, darf er nicht „ins Blaue hinein“ und mit der für ihn günstigsten Ausführungsvariante kalkulieren (Anschluss an BGH, Urteil vom 25.06.1987 – VII ZR 107/86, IBRRS 1987, 0611).
3. Die Regelung des § 2 Abs. 5 VOB/B ist nicht anwendbar, wenn die (vermeintlich) geänderte Leistung bereits vom bestehenden vertraglichen Leistungsumfang umfasst ist, etwa weil ein bestimmter vertraglicher Erfolg auf eine erkennbar kalkulatorisch unklare Leistungsbeschreibung angeboten wurde (Anschluss an BGH, IBR 1992, 349).
4. Die Anordnung einer Änderung des Bauentwurfs kann in der Übergabe geänderter Pläne liegen. Es ist nicht notwendig, dass der Auftraggeber dabei den Willen hat, das beschriebene Leistungssoll zu ändern. Er kann auch davon ausgehen, die geforderte Ausführung gehöre zur vertraglichen Leistung und sei mit den vereinbarten Preisen abgegolten.
5. Notwendig ist jedoch, dass der Auftragnehmer die Erklärung oder das Verhalten des Auftraggebers als Änderungsanordnung auffassen darf. Der Auftragnehmer muss annehmen dürfen, dass dem Auftraggeber bewusst ist, dass er etwas anderes will als ursprünglich vereinbart.
6. Muss der Auftragnehmer erkennen, dass der Auftraggeber die Leistungsbeschreibung anders versteht als er, hat er den Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass er bei seiner Kalkulation von anderen Voraussetzungen ausgegangen ist und durch die vorgesehene Ausführung ein Mehraufwand entstehen wird. Nur dann darf er in der Übergabe geänderter Pläne eine Änderungsanordnung sehen.
OLG Schleswig, Urteil vom 09.12.2022 – 1 U 29/21
vorhergehend:
LG Flensburg, 01.04.2021 – 2 O 373/13
nachfolgend:
BGH, Beschluss vom 25.10.2023 – VII ZR 247/22 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
Gründe:
I.
Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Zahlung restlichen Werklohns.
Die Beklagte schrieb Rohbauarbeiten für den Neubau eines Schulgebäudes nebst Sporthalle aus (Anlage B 1, AB). Sie erteilte der Klägerin am 06.08.2009 den Auftrag unter Einbeziehung der VOB/B. Die Streithelfer waren planende und die Bauaufsicht führende Architekten. Nach Durchführung der Arbeiten und Abnahme stellte die Klägerin ihre Schlussrechnung vom 09.11.2010 (Anlage K 1, AB). Nach Streit über die Abrechnung stützte sie sich zuletzt auf die Forderungsaufstellung vom 11.05.2011 (Anlage K 3, AB).
In verschiedenen Positionen des Leistungsverzeichnisses, zum Beispiel Position 4.1.2.150, war die Herstellung von Stahlbetonunterzügen nach der Statik vorgesehen. In verschiedenen Positionen, zum Beispiel Position 4.2.1.260, war das Mauern tragender Innenwände vorgesehen. In verschiedenen Positionen, unter anderem Position 4.2.1.290, war eine Zulage für das Mauern der letzten Schicht nach Ausschalen der Stahlbetondecke bzw. -balken vorgesehen. Aus der Statik ergab sich, dass es sich bei den Stahlbetonunterzügen überwiegend um nicht tragende obere Wandabschlüsse handeln sollte. Die Klägerin erstellte zunächst die sogenannten Unterzüge als nicht tragende Betonbauteile und stützte sie ab, bis die tragende Wand darunter aufgemauert war. Die Klägerin kündigte in einer Baubesprechung vom 18.11.2009 (Prot. Anlage K 42, Bl. 448 d. A.) Mehrkosten an. Sie stellte mit Schreiben vom 13.04.2010 (Anlage K 38.1, AB) eine Behinderungsanzeige und meldete Mehrkosten an. Sie verlangte schließlich eine Mehrvergütung von 250.687,38 Euro netto nach dem Nachtrag vom 08.11.2010 (Anlage K 17, AB und Bl. 588 d. A).
In der Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis (S. 4, Anlage B 1, AB) war in einem Bauzeitplan der Beginn der Gesamtbaumaßnahme für die 33. Kalenderwoche 2009 vorgesehen. Die Rohbauarbeiten sollten von August 2009 bis März 2010 ausgeführt werden, der wesentliche Teil der Leistungen bis Dezember 2009. In detaillierten Bauzeitplänen, etwa vom 04.08.2009 und 09.09.2009 (Anlagen K 41.2, K 41.3, Bl. 267 – 268 d. A.) war der Abschluss der Betonarbeiten und der Verblendarbeiten bis Dezember 2010 vorgesehen.
Die Klägerin hat behauptet, bei einem Unterzug handele es sich um eine selbsttragende Konstruktion, die die Last der Decke aufnehme und einen Freiraum überbrücke. Aus dem Leistungsverzeichnis sei nicht erkennbar gewesen, dass es sich tatsächlich um nicht tragende Balken als oberen Wandabschluss habe handeln sollen. Die Statik habe ihr bei der Erstellung des Angebots nicht vorgelegen. Sie sei erst an 27.08.2009 übergeben worden. Erst durch die Anweisung des Statikers vor Ort habe sich die danach vorgesehene Bauweise ergeben. Im Leistungsverzeichnis (etwa Position 4.2.1.290) sei vorgesehen gewesen, dass zunächst die Decken und die Balken herzustellen und erst dann die tragenden Wände aufzumauern gewesen seien. Sie habe in ihrer Kalkulation zunächst die Herstellung der Unterzüge und deren Notabstützung, dann die Herstellung der Decken vorgesehen. Stattdessen sei die Schalung für die Decken und die Unterzüge in einem Arbeitsgang herzustellen gewesen, was einen Mehraufwand bedeutet habe, da die Schalung länger habe vorgehalten werden müssen und kein Wechsel von einem Bauteil zum anderen möglich gewesen sei. Die Unterzüge hätten bis zur Aushärtung der Wände abgestützt werden müssen. Es habe sich eine bauzeitverlängernde Leistungsminderung ergeben. Unter anderem habe beim Mauern um die Stützen herum gearbeitet werden müssen. Die Arbeiten seien entgegen der Kalkulation in den strengen Winter 2009/10 gerückt.
In den später von der Beklagten übergebenen Bauzeitplänen liege eine Beschleunigungsanordnung gegenüber dem Bauzeitplan aus der Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis. Die Beklagte habe eine Fertigstellung der Betonarbeiten bis Weihnachten 2009 gefordert. Die Rohbauarbeiten seien nunmehr bis zur 51. KW 2009 abzuschließen gewesen. Ihr stehe deswegen eine Mehrvergütung von 51.470,58 Euro netto nach dem Nachtrag vom 08.11.2010 (Anlage K 18, AB) zu.
Die Klägerin hat die Zahlung von 497.132,05 Euro nebst Zinsen und Kosten verlangt. Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt.
Die Beklagte hat behauptet, im Leistungsverzeichnis sei von Stahlbetonunterzügen die Rede, weil die Bewehrung in die Decke einbinde, was bei Balken nicht immer der Fall sei. Es handele sich dabei um den Sprachgebrauch im Betonbau. Die gewünschte Bauweise habe sich neben der Statik auch aus Plänen ergeben. Die Statik habe der Klägerin bei Angebotsabgabe und Beauftragung vorgelegen, was ihr Geschäftsführer eingeräumt habe (Schreiben vom 05.05.2010, Anlage B 14, Bl. 505 – 506 d. A.). Es sei zunächst die Wand zu erstellen, dann die Decke und der Unterzug zu schalen gewesen. Ein zusätzlicher Leistungsaufwand sei nicht angefallen. Die Reihenfolge der Arbeiten ergebe sich auch aus den Bauzeitplänen der Beklagten und der Klägerin (Anlage B 13, Bl. 490 d. A., Anlagen B 16, B 17, Bl. 1039 – 1045 d. A.).
Aus dem Bauzeitplan in der Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis ergebe sich, dass der Rohbau bis Dezember 2009 so weit habe abgeschlossen sein sollen, dass die vorgesehenen Folgegewerke hätten tätig werden können. So sei ein Fenstereinbau ohne Verblendmauerwerk nicht möglich, für die Ausbaugewerke sei ein geschlossener Bau notwendig gewesen.
Das Landgericht, auf dessen Urteil wegen der näheren Einzelheiten gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat die Beklagte unter Klagabweisung im Übrigen zur Zahlung von 427.021,46 Euro nebst Zinsen verurteilt. Zur Begründung hat es, soweit es in der Berufungsinstanz noch darauf ankommt, ausgeführt, wegen der Herstellung der Balken stehe der Klägerin eine Mehrvergütung von 253.596,85 Euro netto zu. Es handele sich um eine geänderte Leistung. Die Auslegung des Leistungsverzeichnisses ergebe als Leistungssoll selbsttragende Unterzüge, was sich aus den Ausführungen der Sachverständigen ergebe.
Geplant gewesen seien dagegen Balken. Es komme nicht darauf an, ob bei der Abgabe des Angebots die Statik vorgelegen habe. Das Leistungsverzeichnis sei eindeutig, so dass keine Notwendigkeit bestanden habe, die Statik heranzuziehen, um es zu überprüfen, auch wenn im Leitungsverzeichnis auf die Statik Bezug genommen werde. Das Risiko eines Widerspruches zur Statik trage die Beklagte. Nach den Ausführungen der Sachverständigen habe das Leistungsverzeichnis eine bestimmte Reihenfolge der Leistungserbringung vorgesehen, wonach zunächst die Unterzüge und dann das Mauerwerk zu erstellen gewesen seien, was sich insbesondere aus den Positionen 4.2.1.290 und 3.2.1.240 ergebe. Dass eine andere Vorgehensweise nur zu Mehrkosten von 752,47 Euro geführt hätte, sei unerheblich, weil sie dem Inhalt des Leistungsverzeichnisses widersprochen habe.
Wegen einer Beschleunigung des Bauablaufes stehe der Klägerin ein Mehranspruch in Höhe von 44.720,78 Euro netto zu. In den Bauzeitplänen vom 04.08.2009 und 09.09.2009 hätten leistungsändernde Anordnungen gelegen. Nach dem Leistungsverzeichnis seien nur die wesentlichen Teile der Rohbauarbeiten bis Dezember 2009 fertigzustellen gewesen. Nach den Ausführungen der Sachverständigen seien wesentlich die Hülle und das Innenmauerwerk. Nach den Bauzeitplänen habe die Klägerin aber auch das Verblendmauerwerk im Jahr 2009 herstellen sollen. Das sei nicht wesentlich, weil es für Folgegewerke nicht entscheidend gewesen sei.
Gegen dieses Urteil richtet sich die frist- und formgerecht eingereichte und begründete Berufung der Beklagten. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, hinsichtlich der Herstellung der Unterzüge verstoße die Auslegung des Leistungsverzeichnisses durch das Landgericht gegen die Grundsätze der Auslegung. Der Bauvertrag sei als sinnvolles Ganzes auszulegen, wobei alle Vertragsbestandteile einzubeziehen seien. Bei öffentlichen Vergaben komme es auf den objektiven Bieterhorizont an. Es gebe keinen Lehrsatz, dass Unklarheiten zu Lasten des Erstellers eines Leistungsverzeichnisses gingen.
Widersprüche seien nach Möglichkeit aufzulösen. Es seien die Umstände des Einzelfalls und die konkreten Verhältnisse des Bauwerks zu berücksichtigen. Das Landgericht habe die Angaben in der Statik unberücksichtigt gelassen. Es habe nur Teile des Wortlauts des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt. Es habe die Auslegung nicht der Sachverständigen überlassen dürfen. Nach den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen sei bei dem Ausschalen von Wand- und Deckenflächen zum Teil mit erheblichen Zeitverzögerungen zu rechnen gewesen. Im Leistungsverzeichnis sei jeweils Bezug auf die Position in der Statik genommen. Dies sei Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Für einen objektiven Bieter, der die Umstände gekannt habe, sei klar gewesen, dass es sich um nichttragende Bauteile handele, wenn tragende Wände darunter zu errichten gewesen seien. Es habe auch keine zu überspannenden Öffnungen gegeben.
Die Zulage sei nur für die letzte Steinschicht unter den Balken vorgesehen gewesen. Eine Änderung des Auftrags habe es nicht gegeben, da die Statik nicht vom Leistungsverzeichnis abgewichen sei und sie nach dem Schreiben vom 05.05.2010 der Klägerin vor Auftragserteilung vorgelegen habe.
Es fehle eine Anordnung zur Beschleunigung der Bauzeit. Diese liege nicht in der Übersendung des Bauzeitplans, denn die Architekten seien nicht berechtigt gewesen, für sie rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben. Die Betonarbeiten hätten ohnehin bis Weihnachten 2009 fertiggestellt werden müssen, da sie zu den wesentlichen Teilen des Rohbaus gehört hätten. Die Klägerin habe dagegen vorgetragen, es sei die Fertigstellung der Betonarbeiten entgegen des Vertrages gefordert worden. Der Nachtrag habe nichts mit Verblendarbeiten zu tun.
Auf den Hinweisbeschluss vom 18.02.2022 (Bl. 1400 ff. d. A.) weist die Beklagte ergänzend auf Teile der Leistungsbeschreibung hin. In den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen heiße es, dass es sich bei den Stahlbetonarbeiten um Raumtragewerke handele, die Tragkraft erst nach der Abbindezeit für das gesamte Raumtragewerk erreicht werde und die Ausschalung von Wänden und Decken zum Teil mit erheblicher Zeitverzögerung stattfinden könne und nur in Abstimmung mit dem Statikbüro durchzuführen sei (S. 2, Anlage B 1, AB). Die Klägerin habe deswegen nicht mit der Wiederverwendung von Schalungen kalkulieren dürfen.
Hinsichtlich des Nachtrages 7 gebe es keine Beschleunigungsanordnung. Nach dem Leistungsverzeichnis habe ein Gerüst für die Verblendarbeiten und die nachfolgenden Gewerke für 10 Wochen vorgehalten werden sollen (Pos. 1.2.1.010, Anlage B 1, AB). Die Verblendarbeiten hätten vor der Erstellung des Dachüberstandes beendet sein müssen. Die Zimmererarbeiten hätten nach dem Terminplan im Leistungsverzeichnis im November 2009 beginnen sollen.
Die Streithelfer tragen vor, das Leistungssoll sei nicht geändert worden. Die Leistung sei immer gleich beschrieben gewesen. Die Schalung sei von der Vergütung umfasst gewesen. Es fehle jedenfalls einer Abgrenzung der Mehrkosten zu den Kosten der ohnehin vorzuhaltenden Schalung. Wegen der global-funktionalen Beschreibung der Leistung habe die Klägerin die Statik einsehen müssen.
Der Mehraufwand sei bei einer anderen Reihenfolge der Bauausführung vermeidbar gewesen. Die Klägerin habe sich eigenmächtig für die aufwendigere Bauweise entschieden, entgegen der Vorgaben in der Ausführungsplanung und der Statik. Aus dem Leistungsverzeichnis habe sich diese Reihenfolge nicht ergeben.
Es fehle eine Mehrvergütungsankündigung. Die Klägerin habe gegen ihre Hinweispflicht verstoßen, indem sie nicht auf Mehrkosten hingewiesen habe.
Sie behaupten, die Statik sei der Beklagten mit Schreiben vom 13.08.2009 (Bl. 1373 d. A.) übersandt worden.
Die Klägerin beantragt,
das Urteil des Landgerichts Flensburg vom 01.04.2021 – 2 O 373/13 – zu ändern, die Klage in Höhe weiterer 355.407,82 Euro abzuweisen und sie zu verurteilen, an die Klägerin zu zahlen 123.724,23 Euro nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28.02.2011.
Die Streithelfer schließen sich dem Antrag der Beklagten an.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Klägerin verteidigt das Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages. Auf den Hinweisbeschluss vom 18.02.2022 tragen sie vor, die Statik sei nicht Teil der Ausführungsunterlagen gewesen. Erst der Statiker habe darauf hingewiesen, dass die Unterzüge nicht selbsttragend hätten sein sollen. Einen konkreten Hinweis auf die dadurch längere Standzeit der Schalung habe sie den Architekten spätestens bei der Baubesprechung am 18.11.2022 gegeben. Der Vertreter der Beklagten, Herr B1, habe nur selten an Baubesprechungen teilgenommen. E habe sich von den Streithelfern vertreten lassen. Sie habe die Mitteilung von Mehrkosten in ihrem Schreiben vom 13.04.2010 an die Streithelfer und Herrn B1 (Anlage BB 6, Bl. 1429R – 1430 d. A.) dargestellt, in dem es heiße, sie seien schon vor der Ausführung angezeigt worden. In ihrer Antwort vom 13.04.2010 (Anlage BB 7, Bl. 1431 – 1431R d. A.) hätten die Streithelfer die Kenntnis nicht bestritten. Zwar treffe es zu, dass die Betonarbeiten im Jahr 2009 abgeschlossen worden seien, aus dem Schreiben vom 13.04.2010 ergebe sich aber, dass Herr B1 bereits vor den Arbeiten Kenntnis von dem Mehraufwand gehabt habe. Die Beklagte habe von dem Mehraufwand auch Kenntnis erlangt, weil durch die zusätzlichen Abfangungsmaßnahmen ein „Stützenwald“ entstanden sei und die Arbeiten länger gedauert hätten.
Hinsichtlich der Höhe des Anspruchs seien die Innenwände nach dem Wortlaut des Leistungsverzeichnisses zunächst ohne die letzte Schicht zu mauern gewesen. Erst später seien die letzten Schichten zu mauern gewesen. Nach den Bauzeitplänen der Parteien seien erst die Innenwände zu mauern gewesen, dann die Stahlbetonarbeiten auszuführen gewesen. Später hätten die Lücken geschlossen werden sollen. Das sei die übliche Reihenfolge. Sie habe darin kein Problem gesehen, weil sie von selbsttragenden Bauteilen ausgegangen sei. Die von ihr gewählte Reihenfolge sei bekannt gewesen. Sie habe mit Schreiben vom 14.04.2010 (Anlage BB 9, Bl. 1436 d. A.) Bedenken gegen das nachträgliche Aufmauern der Wände angemeldet, die von den Streithelfern mit Schreiben vom 15.04.2010 (Anlage BB 10, Bl. 1425 d. A.) zurückgewiesen worden seien.
Hinsichtlich des Nachtrages 7 sei die Überschrift missverständlich. Sie beschreibe nicht den Inhalt des Nachtrages. Der Hintergrund der Beschleunigung ergebe sich aus dem Gutachten der Sachverständigen vom 21.02.2020, S. 21 – 23. Sie habe die gesamte Leistung erbringen sollen. Der Abbau des Krans bedeute das Ende der Rohbauarbeiten.
Der Senat hat Beweis erhoben durch Anhörung der Sachverständigen K1 und Vernehmung des Zeugen K2. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Protokolle der Sitzungen vom 04.02.2022 (Bl. 1355 – 1360 d. A.) und vom 18.11.2022 (Bl. 1539 – 1546 d. A.) Bezug genommen.
II.
Die zulässige Berufung der Beklagten ist in der Sache bis auf einen geringen Teil in der Sache erfolgreich.
Der Klägerin steht kein Werklohnanspruch aus § 631 Abs. 1 BGB wegen der Nachträge 6 und 7 zu.
1. Der Klägerin steht kein Mehrkostenanspruch aus § 2 Abs. 5 VOB/B wegen einer Leistungsänderung bei der Herstellung der Unterzüge zu. Sie hat nicht bewiesen, dass eine der Beklagten zurechenbare Änderungsanordnung erfolgt ist.
a) Ein Anspruch aus § 2 Abs. 5 VOB/B entsteht, wenn sich die Preisgrundlage für eine im Vertrag vorgesehene Leistung ändert, etwa weil die Leistung anders ausgeführt werden soll als ursprünglich vorgesehen (Ingenstau/Korbion/Keldungs, VOB, 21 Aufl., § 2 Abs. 5 VOB/B, Rn. 3, 5, 6, 9). Dagegen liegt ein Fall des § 2 Abs. 6 VOB/B vor, wenn eine vertraglich noch nicht vorgesehene Leistung gefordert wird, der Leistungsinhalt also erweitert wird, ohne dass der bisherige Leistungsinhalt geändert wird (Ingenstau/Korbion/Keldungs, VOB, 21 Aufl., § 2 Abs. 5 VOB/B, Rn. 8). Das korrespondiert mit den Regelungen in § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B, aus denen sich ergibt, wann der Auftragnehmer Anordnungen des Auftraggebers nachkommen muss, nämlich bei Änderungen des Bauentwurfs und bei Zusatzleistungen, die zur Ausführung der vereinbarten Leistung erforderlich werden (Ingenstau/Korbion/Keldungs, VOB, 21 Aufl., § 1 Abs. 3 VOB/B, Rn. 2, § 1 Abs. 4 VOB/B, Rn. 1, 3).
Ob die von den Streithelfern zitierte Entscheidung (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12.02.2021, 22 U 245/20) die Vorschriften anders auslegen will, wird nicht deutlich. Jedenfalls wäre eine Revision nicht wegen einer Abweichung von dieser Entscheidung zuzulassen, weil die Entscheidung nicht auf der Auslegung des § 2 Abs. 5, 6 VOB/B beruht. Sie geht vielmehr davon aus, dass die VOB/B in dem zu beurteilenden Fall nicht wirksam in den Vertrag einbezogen war.
Danach ist die Vorschrift des § 2 Abs. 5 VOB/B einschlägig. Denn die Herstellung von Unterzügen war von Anfang an vorgesehen. Es geht allein darum, auf welche Weise sie hergestellt werden sollten.
b) Die Ausführung der Unterzüge, wie die Statik sie vorsah, wich von der Ausführung ab, von der die Klägerin nach dem Leistungsverzeichnis ausgehen durfte. Die Unterzüge sollten danach überwiegend nicht als freitragende Bauteile errichtet werden. Diese Abweichung ist als Änderung des Bauentwurfs i. S. d. § 2 Abs. 5 VOB/B zu werten.
aa) Bei einer öffentlichen Ausschreibung ist der Vertragsinhalt durch die Auslegung der Leistungsbeschreibung zu bestimmen. Eine Änderung der Preisgrundlage kommt nur in Betracht, wenn sich durch einen späteren Eingriff des Auftraggebers der vereinbarte Leistungsinhalt geändert hat (Ingenstau/Korbion/Keldungs, VOB, 21. Auflage, § 2 Abs. 5 VOB/B, Rn. 5).
(1) Der Inhalt einer öffentlichen Ausschreibung ist nach den Regeln der §§ 133, 157 BGB auszulegen, wobei es auf den objektiven Empfängerhorizont eines fachkundigen, mit der angefragten Leistung vertrauten Bieters ankommt (BGH, Beschluss vom 07.01.2014, X ZB 15/13; OLG Frankfurt, Beschluss vom 01.10.2020, 11 Verg 9/20). Nach den allgemeinen Auslegungsgrundlagen ist bei der Auslegung von dem Wortlaut der Erklärung auszugehen. Es sind nur die Umstände zu berücksichtigen, die dem Empfänger der Erklärung bei Zugang der Willenserklärung erkennbar waren (BGH, Beschluss vom 13.10.2011, VII ZR 222/10). Die Auslegung hat unter Berücksichtigung des Vertragsinhalts, der sonstigen Umstände und des mit dem Vertrag verfolgten Zwecks zu verfolgen (BGH, Urteil vom 30.06.2011, VII ZR 13/10).
(2) Bei der Auslegung ist danach nicht allein auf den Wortlaut der Positionen des Leistungsverzeichnisses und dort allein auf die Bedeutung des Worts „Unterzüge“ abzustellen. Die Auslegung hat jedoch von der Bedeutung dieses Wortlauts auszugehen.
Nach den Feststellungen des Landgerichts auf der Grundlage der Ausführungen der Sachverständigen ist unter einem Unterzug ein selbsttragendes Bauteil zu verstehen. Konkrete Anhaltspunkte Zweifel an dieser Feststellungen i. S. d. § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO zeigt die Berufung nicht auf.
(3) Die Statik kann nur dann zur Auslegung der Vereinbarung herangezogen werden, wenn sie der Klägerin bei Angebotserstellung bekannt war. Das hat die Beklagte nicht unter Beweis gestellt.
Die Statik war nicht Teil der Vergabeunterlagen. Sie ist nicht in den von der Beklagten als Anlage B 1 vorgelegten Unterlagen enthalten. Bestandteil der Vergabeunterlagen waren einige Zeichnungen, von denen unklar geblieben ist, ob sich aus ihnen ergab, dass die Unterzüge nicht selbsttragend sein sollten.
Das Schreiben vom 13.08.2009 (Bl. 1373 d. A.) allein ist nicht geeignet, den Beweis zu erbringen, dass die relevanten Teile der Statik übersandt worden sind. In dem Schreiben wird ein Satz statische Unterlagen nach einer Planliste erwähnt, ohne dass deutlich wird, welche Unterlagen das gewesen sind. Es kann sich auch nur um die erwähnten Schalpläne gehandelt haben. Zudem ist aus dem Schreiben allein nicht erkennbar, ob die Unterlagen tatsächlich beilagen.
Im Übrigen wäre die Übergabe zwar vor dem Vertragsschluss, aber nach dem Angebot erfolgt. Grundlage für die Kalkulation konnte die Statik damit nicht mehr werden. Sie wäre für die Auslegung des Leistungsverzeichnisses und damit für das Verständnis des Angebots der Klägerin vom 29.06.2009 unerheblich. Es kommt so auch nicht darauf an, ob sich aus dem Schreiben der Klägerin vom 05.05.2010 (Anlage B 14, Bl. 504 – 506 d. A.) ergibt, dass ihr die Statik bei Auftragserteilung vorlag.
Auch dann wäre der Preis anzupassen. Es dürfte sogar so sein, dass bei einer Änderungsanordnung vor Vereinbarung einer Leistung nicht § 2 Abs. 5 VOB/B eingreift, sondern der übliche Preis heranzuziehen ist (Ingenstau/Korbion/Keldungs, VOB, 21 Aufl., § 2 Abs. 5 VOB/B, Rn. 3).
(4) Dass in den die Unterzüge betreffenden Positionen des Leistungsverzeichnisses (Pos. 3.1.1.480, 3.1.1.490, 3.1.1.500, 3.1.1.510, 3.1.1.520, 3.1.2.180, 3.1.2.190, 3.1.2.200, 3.1.2.210, 4.1.2.150 – 4.1.2.240, 4.1.2.420, 4.1.2.430) jeweils auf die Statik Bezug genommen wurde, bedeutet nicht, dass die Klägerin sie hätte anfordern müssen. Denn sie musste allein aufgrund dieses Hinweises keinen Anlass zu der Annahme haben, dass sich aus der für die Erstellung des Angebots nicht übergebenen Statik angebotsrelevante Umstände ergaben.
(5) Aus dem weiteren Inhalt der die Unterzüge betreffenden Positionen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich überwiegend nicht um selbsttragende Bauteile handeln sollte. Nach den Ausführungen der Sachverständigen im Termin vom 04.02.2022 (Prot. S. 3, Bl. 1357 d. A.) sprechen weder die Maße noch die Anzahl der Unterzüge gegen die Annahme, dass selbsttragende Bauteile geplant waren.
(6) Aus dem Umstand, dass im Leistungsverzeichnis auch tragende Innenwände vorgesehen waren (Pos. 3.2.1.210, 3.2.1.270, 4.2.1.260, 4.2.1.320, 4.2.1.360), lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass die Unterzüge nicht selbsttragend sein sollten. Es kann nach den Ausführungen der Sachverständigen bautechnisch Sinn ergeben, zum Schutz des Mauerwerks dieses erst nach Abschluss der Betonarbeiten aufzumauern. Auch müssen lange Unterzüge teilweise unterstützt werden, was auch durch tragende Innenwände möglich ist (Prot. v. 04.02.2022, S. 3, 5, Bl. 1357, 1359 d. A.).
Auch der Wortlaut der Zulagepositionen für das spätere Mauern der letzten Schichten unter der Stahlbetondecke bzw. dem Stahlbetonbalken nach dem Ausschalen der Stahlbetondecke (Pos. 3.2.1.240, 3.2.1.290, 4.2.1.290, 4.2.1.340, 4.2.1.380) weist nicht eindeutig auf nicht selbsttragende Bauteile hin.
Nach den Ausführungen der Sachverständigen wird der Begriff Balken sowohl für selbsttragende als auch für nicht selbsttragende Betonbauteile verwendet (Prot. v. 04.02.2022. S. 5 f., Bl. 1359 f. d. A.).
bb) Auch wenn die Statik von Anfang an die Ausführung der Unterzüge weitgehend als nichttragende Bauteile vorsah, ist in der Ausführung nach der Statik eine andere Ausführung der Leistung zu sehen. Denn der Vertragsinhalt auf der Grundlage der dargestellten Auslegung des Leistungsverzeichnisses sah die Ausführung als tragende Bauteile vor.
Dass die Statik von Anfang an die Ausführung als nichttragende Bauteile vorsah, ist unstreitig. Die Klägerin hat nur bestritten, dass die Statik ihr bei der Erstellung des Angebots vorlag, aber nicht behauptet, dass sie nachfolgend geändert worden wäre. Sie hat nur von der Übergabe einer Nachtragsstatik gesprochen, ohne zu behaupten, dass die Änderung die hier relevante Leistung betraf oder dass sie der Angebotserstellung nachfolgte. Sie ist dem Vortrag der Beklagten, dass die Statik wegen der Ausführung der Unterzüge nie geändert worden ist, nicht entgegengetreten. Sie ist auch den Feststellungen des Landgerichts nicht entgegengetreten, nach denen es einen Widerspruch zwischen der Statik und dem Text des Leistungsverzeichnisses gab. Zumindest hat die Klägerin keinen Beweis für eine nachträgliche Änderung angeboten.
Auch in der Berufungserwiderung macht die Klägerin nur geltend, dass die Statik erst am 27.08.2009 geprüft und ihr auf einer CD mit dem Datum 30.09.2009 übergeben worden sei. Sie bezieht sich dabei auf Statiken, die am 02.09.2008 bzw. 17.03.2009 aufgestellt worden sind (Anlage BB 3, Bl. 1250 – 1251 d. A.), und damit deutlich vor dem Angebot.
c) Die Klägerin hat nicht bewiesen, dass eine der Beklagten zurechenbare Leistungsanordnung erfolgt ist.
aa) Für eine Leistungsanordnung im Sinne von § 2 Abs. 5 VOB/B notwendig ist eine rechtsgeschäftliche, mit Vertretungsmacht abgegebene Erklärung, in der der Bauherr die geänderte Bauweise anordnet (OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.10.2013, 22 U 21/13). Die Anordnung kann ausdrücklich, aber auch konkludent erfolgen, etwa dadurch, dass der Auftraggeber in Kenntnis geänderter Bedingungen die Arbeiten fortsetzen lässt (Ingenstau/ Korbion/Keldungs, VOB, 21. Auflage, § 2 Abs. 5 VOB/B, Rn. 20). Eine Anordnung kann in der Übergabe geänderter Pläne liegen (KG, Urteil vom 21.04.2016, 27 U 81/15; Kapellmann, Messerschmidt, VOB, 7. Aufl., § 2 VOB/B, Rn. 340). Es ist nicht notwendig, dass der Auftraggeber dabei den Willen hat, das Bausoll zu ändern. Er kann auch davon ausgehen, die verlangte Ausführung sei vom Bausoll gedeckt (Kapellmann, Messerschmidt, VOB, 7. Aufl., § 2 VOB/B, Rn. 340).
Notwendig ist jedoch, wie bei jeder Willenserklärung, dass der Auftraggeber die Erklärung oder das Verhalten des Auftraggebers nach dem objektiven Empfängerhorizont als Änderungsanordnung auffassen darf. Der Auftragnehmer muss annehmen dürfen, dass dem Bauherrn bewusst ist, dass er etwas anderes will als ursprünglich vereinbart.
bb) Es ist danach nicht ausreichend, dass der Klägerin die Statik übergeben worden ist und sie unstreitig danach bauen sollte. Die Besonderheit des Falles liegt darin, dass aufseiten der Beklagten das Leistungsverzeichnis anders verstanden wurde als aufseiten der Klägerin. Es war für die Klägerin erkennbar, dass die Statik hinsichtlich der Ausführungsart der Unterzüge nie geändert worden war. Sie musste erkennen, dass die Streithelfer den Begriff anders verwendet hatten als er gemeinhin zu verstehen ist.
In dieser Situation musste die Klägerin einem Vertreter der Beklagten deutlich machen, dass sie bei ihrer Kalkulation von anderen Voraussetzungen ausgegangen war und durch die vorgesehene Ausführung nunmehr erheblicher Mehraufwand entstehen werde. Nur dann durfte sie in der Übergabe der Statik oder in dem Zulassen der Fortsetzung der Arbeiten eine Änderungsanordnung sehen.
cc) Inwieweit die Streithelfer von diesen Umständen Kenntnis erhalten haben, kann dahinstehen. Denn sie hatten unstreitig keine Vertretungsmacht für die Beklagte. Sie konnten so keine rechtsgeschäftlichen Erklärungen für diese abgeben.
Etwaige Kenntnisse der Streithelfer waren der Beklagten nicht analog § 166 Abs. 2 BGB zuzurechnen. Ein Geschäftsherr muss sich entsprechend § 166 Abs. 1 BGB und mit Rücksicht auf Treu und Glauben (§ 242 BGB) auch die Kenntnis eines Wissensvertreters zurechnen lassen. Wissensvertreter ist jeder, der nach der Arbeitsorganisation des Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als dessen Repräsentant bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen und die dabei anfallenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen sowie gegebenenfalls weiterzuleiten (BGH, Urteil vom 26.05.2020, VI ZR 186/17).
Die Streithelfer waren nicht in eine solche Art und Weise in die Organisation der Beklagten eingebunden.
Sie waren allein damit betraut, das Bauvorhaben zu planen und zu überwachen, damit die Schulgebäude mangelfrei errichtet werden konnten. Dazu gehörte nicht die Kenntnisnahme und Weiterleitung von Informationen, die zu Änderungen der vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Bauunternehmerin und der Bauherrin führen konnten.
Die Klägerin durfte zudem nicht davon ausgehen, dass die Streithelfer etwaige Kenntnisse von der Problematik an die Beklagte weiterleiten würden. Denn die Streithelfer hatten das Leistungsverzeichnis verfasst und waren damit für die Wahl des missverständlichen Begriffes „Unterzug“ verantwortlich. Sie hätten sich bei einer Weiterleitung der Informationen an die Beklagte selbst belastet. Sie zeigten sich auch nicht einsichtig, sondern waren mit der Geltendmachung von Mehrkosten nicht einverstanden. In einer solchen Situation muss sich der Unternehmer an den Bauherrn selbst wenden.
Diese Frage ist ebenso zu beurteilen wie bei der Erteilung eines Bedenkenhinweises nach §§ 13 Abs. 3, 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B. Auch mit einem Bedenkenhinweis muss sich der Unternehmer jedenfalls dann direkt an den Bauherrn wenden, wenn er Bedenken gegen Anordnungen oder Planungen des Architekten selbst hat (BGH, Urteil vom 19.12.1996, VII ZR 309/95; OLG Oldenburg, Urteil vom 15.10.1997, 2 U 178/97) oder der Architekt sich der Bedenkenanmeldung durch den Unternehmer verschließt (BGH, Urteil vom 19.01.1989, VII ZR 87/88; BGH, Urteil vom 19.12.1996, VII ZR 309/95; Senat, Urteil vom 24.05.2019, 1 U 71/18; OLG Düsseldorf, Baurecht 1995, 244, 245; OLG Celle, Urteil vom 21.10.2004, 14 U 26/04; OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.02.2013, 23 U 185/11; Ingenstau/Korbion/Wirth, VOB, 21. Aufl., § 13 Abs. 3 VOB/B, Rn. 78).
Ob der Beklagten ein Planungsverschulden der Streithelfer anzurechnen ist, ist unerheblich, weil die Klägerin nicht Schadensersatz geltend macht, sondern Werklohn.
dd) Auch Herr B1 war nicht für rechtsgeschäftliche Erklärungen für die Beklagte gegenüber der Klägerin bevollmächtigt. Die Klägerin durfte das auch nicht annehmen. In dem von dem Bürgermeister unterschriebenen Auftragsschreiben vom 06.08.2022 (Anlage B 1, AB) wird Herr B1 als Mitarbeiter im Gebäudemanagement bezeichnet. Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht ist mit einer solchen Position regelmäßig nicht verbunden.
Ob Wissen von Herrn B1 der Beklagten analog § 166 Abs. 2 BGB zuzurechnen wäre, kann offenbleiben.
Denn es steht nicht fest, dass er von den oben bezeichneten Umständen Kenntnis hatte.
ee) Schriftverkehr mit der Beklagten – oder auch nur mit den Streithelfern – aus dem Jahr 2009 legt die Klägerin nicht vor. Als einzige schriftliche Unterlage aus dem fraglichen Zeitraum legt sie das Protokoll der Baubesprechung vom 18.11.2009 (Anlage K 42, Bl. 448 d. A.) vor, in der Mehrkosten wegen längerer Schalungszeiten angekündigt wurden. Ob das Protokoll einem Vertreter der Beklagten zur Kenntnis gelangt ist, ist unbekannt. Das folgt nicht allein daraus, dass Herr B1 im Verteiler genannt wird.
Nach dem Vortrag der Klägerin sollen Mehrkosten dabei zum ersten Mal zur Sprache gebracht worden sein.
Das wäre erheblich nach dem Beginn der Betonarbeiten gewesen. Auch die Höhe der Mehrkosten wird in dem Protokoll nicht näher dargelegt. Es soll nachfolgend eine erste Kostenzusammenstellung vom 15.12.2009 gegeben haben. Auch eine solche legt die Klägerin nicht vor.
Die Klägerin beruft sich in erster Linie auf ihr Schreiben vom 13.04.2010 (Anlage BB 6, Bl. 1429R – 1430 d. A.), in dem angeführt wird, der Mehrbedarf und die Gründe dafür seien „Ihnen“ vor Ausführung der Arbeiten bekannt gemacht worden. Das Schreiben ist als solches nicht zum Beweis geeignet, weil es unstreitig nach dem Abschluss der Betonarbeiten verfasst worden ist. Ob und auf welche Weise die Vertreter der Beklagten Kenntnis erhalten haben sollen, ergibt sich daraus zudem nicht. Ob die Streithelfer die Darstellung bestritten haben, ist unerheblich. Auf solche vorprozessualen Vorgänge sind die prozessualen Regeln nicht anzuwenden.
ff) Nach den Angaben des Geschäftsführers der Klägerin im Termin vom 04.02.2022 (insoweit nicht protokolliert) soll über die Frage gesprochen worden sein, nachdem die Anforderungen aus der Statik bekannt geworden waren. Es ist aber offengeblieben, mit wem gesprochen worden ist und wie genau die Angaben dabei waren.
gg) Es reicht nicht aus, wenn durch den Mehraufwand nunmehr ein „Stützenwald“ entstand, oder, dass die Dauer der Arbeiten sich verlängerte. Die Vertreter der Beklagten mussten keine Vorstellung davon haben, auf welche Weise oder mit welchem Aufwand die Klägerin die Unterzüge herstellen wollte. Sie konnten so nicht erkennen, ob sich etwas geändert hatte.
hh) Der Senat ist nach der Aussage des Zeugen K2 nicht überzeugt, dass Vertreter der Beklagten die notwendigen Informationen erhalten haben.
Der Zeuge K2 hat bekundet (Prot. v. 18.11.2022, S. 2 ff., Bl. 1540 ff. d. A.), es sei gegenüber dem bauleitenden Architekten Herrn F1 dargelegt worden, dass es zu Mehrkosten komme. Nach seiner Erinnerung sei Herr B1 auch im Thema gewesen. Herr B1 habe an Baubesprechungen teilgenommen und die Protokolle erhalten. Überwiegend sei mündlich gesprochen worden, es habe aber auch jede Menge Schriftverkehr gegeben. Mehrkosten sei widersprochen worden. Eine genaue Situation könne er nicht mehr erinnern. Das Schreiben vom 13.04.2010 habe er verfasst. Herr F1 habe einmal handschriftlich eine Zahl notiert, die zur Lösungsfindung habe dienen sollen. Das habe aber nicht zu einer Einigung geführt.
Die Aussage ist weder für sich noch im Zusammenhang mit dem Schreiben vom 13.04.2010 glaubhaft. Es fehlen Realkennzeichen für die Aussage, dass Herr K2 oder ein anderer Vertreter der Klägerin mit Herrn B1 über die Mehrkosten und deren Ursachen gesprochen haben. Herr K2 konnte keine konkrete Situation schildern, in der es zu einem solchen Gespräch gekommen sein soll.
Herr K2 schränkte seine Aussage teilweise dahin ein, dass er aufgrund des Schriftverkehrs davon ausgehe, Herr B1 sei informiert gewesen, Herr B1 sei verschiedentlich auf der Baustelle gewesen und habe das Thema wahrgenommen oder man sei zwar bei Baubesprechungen teilweise in verschiedenen Gruppen über die Baustelle gegangen, er gehe aber davon aus, dass das Thema unter anderem Herrn B1 bekannt gewesen sei (Prot. v. 18.11.2022, S. 2, 3, Bl. 1540, 1541 d. A.). Danach kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr K2 nur aufgrund der auf der Baustelle geführten Gespräche darauf schließt, dass auch Herr B1 informiert gewesen sei. Im Übrigen ist nicht glaubhaft, dass es eine große Anzahl von Schreiben aus dem Jahr 2009 zu dem Problem gab. Die Klägerin hat solche Schreiben, wie gesagt, nicht vorgelegt.
Die Aussage wird nicht dadurch glaubhaft, dass Herr K2 bekundet hat, er habe das Schreiben vom 13.04.2010 verfasst und die darin aufgeführten Punkte seien seinerzeit angesprochen worden. Das ersetzt nicht die fehlende Erinnerung daran, in welcher Situation mit wem ein solches Gespräch geführt worden sein soll.
Ob der Streithelfer Herr F1 einmal mit dem Ziel einer Einigung eine Zahl notiert hat, ist unerheblich. Ihm fehlte jedenfalls die Vertretungsmacht für die Beklagte. Im Übrigen fehlt zu einem solchen Vorgang Vortrag der Klägerin.
d) Ein Anspruch der Klägerin ergibt sich auch nicht nach den Regelungen des § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B. Sie hat nicht dargelegt, jedenfalls nicht bewiesen, dass ein Vertreter der Beklagten die geänderte Leistung anerkannt hat oder die geänderte Leistung einem Vertrete der Beklagten unverzüglich angezeigt worden ist.
Das würde wiederum ein Bewusstsein einer geänderten Leistung bei einem Vertreter der Beklagten voraussetzen. Insoweit kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden.
e) Abgesehen von dem fehlenden Anspruchsgrund hat die Klägerin auch die Höhe des Anspruchs nicht plausibel dargelegt.
aa) Ein erheblicher Teil der Mehrkosten soll dadurch entstanden sein, dass die Klägerin die Schalungen für die Unterzüge nicht mehrmals verwenden konnte, weil die nicht selbsttragenden Unterzüge abgestützt werden mussten. Die Klägerin durfte bei ihrer Kalkulation allerdings nicht von einer mehrfachen Verwendung der Schalung ausgehen.
In den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen ist geregelt, dass es sich bei den Stahlbetonarbeiten um Raumtragewerke handelt, die Tragkraft erst nach der Abbindezeit für das gesamte Raumtragewerk erreicht wird und die Ausschalung von Wänden und Decken z. T. mit erheblicher Zeitverzögerung stattfinden kann und nur in Abstimmung mit dem Statikbüro durchzuführen ist (S. 2, Anlage B1, AB). Die Klägerin musste danach damit rechnen, dass die Schalung länger vorgehalten werden musste, nämlich bis der Statiker das Ausschalen genehmigte.
Es handelt sich dabei nicht vornehmlich um eine technische Frage, sondern um die Auslegung der Vertragsbedingungen. Es ist deswegen nicht erheblich, dass die Sachverständige im Termin vom 18.11.2022 ausgeführt hat, bei normalen Abbindezeiten habe die Schalung öfter verwendet werden können. Ein früheres Ausschalen sei mit Zustimmung des Statikers möglich. Nach der Abbindezeit sei die Zustimmung nicht notwendig (Prot. S. 6 f, Bl. 1543 f. d. A.). Die Sachverständige hat damit nur ein übliches Vorgehen auf einer Baustelle geschildert. In den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen wurde aber gerade klargestellt, dass mit Zeitverzögerungen zu rechnen war. Die Klägerin hätte deswegen nicht ohne Nachfrage den üblichen Bauablauf ihrer Kalkulation zugrunde legen dürfen. Das gilt auch dann, wenn der Begriff des Raumtragewerks im Betonbau nicht üblich ist (Prot. v. 18.11.2022, S. 7, Bl. 1545 d. A.). Ein solcher erkennbarer Widerspruch hätte erst recht zu der Nachfrage führen müssen, was gemeint war.
Nach der Aussage des Zeugen K2 gibt es sogar einen Anhaltspunkt dafür, dass die von der Klägerin geltend gemachte Problematik ihre Ursache darin hatte, dass sie den Hinweis in den besonderen technischen Vertragsbedingungen nicht beachtet hat. Er hat bekundet, es habe sich herausgestellt, dass die Tragfähigkeit nur durch das Gesamtwerk, nämlich die Unterzüge und das Dach, habe hergestellt werden können (Prot. v. 18.11.2022, S. 4, Bl. 1542 d. A.). Das deutet auf den in den Vertragsbedingungen beschriebenen Umstand, hin, dass die Tragkraft erst nach Fertigstellung und Abbindezeit des gesamten Raumtragewerks erreicht wird.
bb) Ein Teil der Mehrkosten soll dadurch entstanden sein, dass das Aufmauern der tragenden Wände zwischen der Abfangung der Unterzüge erschwert gewesen sei und sich unter anderem dadurch eine Bauzeitverzögerung ergeben habe. Diese Kosten wären vermeidbar gewesen, wenn vor der Herstellung der Unterzüge die Wände gemauert worden wären. Nach den Ausführungen der Sachverständigen hätte das Vorgehen in anderer Reihenfolge auch bei der Annahme, dass die Klägerin zunächst von freitragenden Bauteilen ausgehen durfte, nur zu Mehrkosten von 752,47 Euro netto geführt (EGA v. 11.02.2020, S. 14).
Die von der Klägerin gewählte Reihenfolge war nicht im Leistungsverzeichnis vorgeschrieben. Aus ihm ergibt sich keine bestimmte Reihenfolge der Arbeiten. Eher ergibt sich, dass die Wände größtenteils vor der Erstellung der Decken hergestellt werden sollten. Auf die gegenteiligen Ausführungen der Sachverständigen (Prot. v. 12.02.2021, S. 3 f., Bl. 1021 f. d. A.) kommt es nicht an, weil es sich nicht um technische Fragen handelt. Die Auslegung des Leistungsverzeichnisses ist eine Rechtsfrage. Es kommt für die Auslegung auch nicht darauf an, ob die Rechtsanwälte der Beklagten im Nachhinein geäußert haben, die Vorgehensweise der Klägerin sei richtig gewesen.
Für die Positionen, die die Herstellung der tragenden Innenwände vorsahen, war jeweils eine Zulage für das spätere Mauern der letzten Schichten vorgesehen (Pos. 3.2.1.210 und 3.2.1.240, 3.2.1.270 und 3.2.1.290, 4.2.1.260 und 4.2.1.290, 4.2.1.320 und 4.2.1.340, 4.2.1.360 und 4.2.1.380 des LV). Bei der gebotenen Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont ergab sich daraus, dass die tragende Innenwand bereits mit Ausnahme der letzten Schichten hergestellt sein sollte, bevor die Stahlbetondecke hergestellt wurde, denn sonst hätte es nicht der Beschreibung „später“ bedurft, die eine Unterbrechung der Arbeiten nahelegt.
Hätten erst die Decken und danach die Wände hergestellt werden sollen, hätte es keines Zusatzes, der auf eine Unterbrechung der Arbeiten hinweist, bedurft.
Dass das Aufmauern der Wände vor den Betonarbeiten geplant war, ergibt sich aus den Bauzeitplänen. So sah etwa der Plan der Beklagten (Anlage B 13, Bl. 490 d. A.) das Aufmauern von Wänden im Untergeschoss für die 37./38. Kalenderwoche, das Herstellen der Stahlbetondecke jedoch erst für die 38./39. Kalenderwoche vor. Im Erdgeschoss sollte das Aufmauern der Wände in der 40./41. Kalenderwoche erfolgen, das Herstellen der Decken in der 42. Kalenderwoche. Ähnliches ergibt sich aus dem von der Klägerin erstellten Bauzeitplan vom 21.09.2009 (Bl. 1039 ff. d. A.). Danach hätte etwa das Aufmauern der Wände im Untergeschoss bis zur 39. Kalenderwoche dauern sollen, das Herstellen der Decke hätte in der 38./39. Kalenderwoche geschehen sollen. Der Ablauf der Herstellung von Mauerwerk und Decke im Erdgeschoss hätte nicht verändert werden sollen. Außerdem war zu einem späteren Zeitpunkt die Herstellung restlichen Ziegelmauerwerks vorgesehen, wobei es sich um das Aufmauern der letzten Schichten handeln dürfte.
Dieser Auslegung des Leistungsverzeichnisses und der Bauzeitpläne hat die Klägerin in der Stellungnahme zum Hinweisbeschluss vom 18.02.2022 ausdrücklich zugestimmt. Soweit sie geltend gemacht hat, die von ihr – danach frei gewählte – Vorgehensweise sei der Beklagten bekannt gewesen, ist das unerheblich.
Abgesehen davon, dass unklar geblieben ist, ob für die Beklagte Vertretungsberechtigte Kenntnis hatten, kann aus dem bloßen Umstand, dass dem Bauherrn eine vom Unternehmer frei gewählte Reihenfolge der Arbeiten bekannt ist, kein Mehrkostenanspruch erwachsen.
Die Klägerin hat auf den Hinweisbeschluss vom 18.02.2022 nicht dargelegt, welche Mehrkosten entstanden wären, wenn sie zunächst die Wände gemauert hätte, oder, aus welchem Grund eine solche Reihenfolge nicht möglich gewesen sein soll, als ihr die Anforderungen aus der Statik bekannt wurden. Dabei ist von Bedeutung, dass bereits im Untergeschoss der Sporthalle (Titel 3.1.1) Unterzüge vorgesehen waren und aus den Anforderungen der Statik an sie Rückschlüsse für die Ausführung der Unterzüge jedenfalls im Obergeschoss der Sporthalle hätten gezogen werden müssen.
Die Klägerin hat nur geltend gemacht, dass sich die Mehrkosten auf das Mauern der letzten Schichten bezögen. Eine solche Einschränkung geht weder aus dem Nachtrag 6 noch aus ihrem Vortrag in diesem Rechtsstreit hervor. Im Gegenteil geht die Vorbemerkung des Nachtrags (Ziff. 3 der Beschreibung des Mehraufwands, S. 2) offensichtlich von der Herstellung des gesamten unter den Unterzügen angeordneten Mauerwerks aus. Außerdem ist unstreitig, dass die Klägerin die gesamten Wände erst nach der Herstellung der Unterzüge aufgemauert hat. Sie selbst spricht von einem „Stützenwald„, der auf der Baustelle entstanden sei.
2. Mehrkosten nach dem Nachtrag 7 für eine Beschleunigung des Bauablaufes stehen der Klägerin nicht zu.
Tatsächlich ist eine relevante Beschleunigung des Bauablaufes nicht erfolgt. Zumindest fehlt es an einer der Beklagten zurechenbaren Beschleunigungsanordnung.
a) Die Klägerin macht mit dem Nachtrag 7 Mehrkosten dafür geltend, dass die Betonarbeiten bis Weihnachten 2009 fertigzustellen waren. Das war zwischen den Parteien indes bereits im Vertrag vom 06./20.08.2009 vereinbart worden.
aa) Das dem Vertrag zugrunde liegende Leistungsverzeichnis enthielt in der Vorbemerkung bereits einen groben Bauzeitplan, nach dem die wesentlichen Teile der Rohbauarbeiten bis Dezember 2009 beendet sein sollten (S. 4 der Vorbemerkungen, Anlage B 1, AB). Aus dem für die Ausbaugewerke vorgesehenen Leistungsbeginn ist zu erkennen, dass das Bauwerk zu diesem Zeitpunkt bereit für den Einbau der Fenster und ab da geschlossen für den Beginn des Innenausbaus sein musste. Nach den Ausführungen der Sachverständigen (1. EGA v. 11.02.2020, S. 22) ist daraus jedenfalls zu schließen, dass die Betonarbeiten abgeschlossen sein mussten. Die Herstellung der Sohle, der Außenwände sowie der Decken war notwendig, um einen geschlossenen Bau zu erreichen.
bb) Die Überschrift des Nachtrags ist nicht missverständlich. Er enthält das, was mit der Überschrift angekündigt wird, nämlich Kosten für die Fertigstellung der Betonarbeiten bis Dezember 2009, die indes bereits ursprünglich vertraglich geschuldet war. Die beiden Positionen weisen Schalarbeiten und die Zuteilung eines zweiten Poliers jeweils bis zum 18.12.2009 aus. Es ging somit nicht um die Fertigstellung der Betonarbeiten innerhalb eines verkürzten, vor Dezember 2009 endenden Zeitraums. Das entspricht auch dem durchgehenden Vortrag der Klägerin.
Insofern kann sich die Klägerin nicht auf die Ausführungen der Sachverständigen in dem Ergänzungsgutachten vom 11.02.2020 (S. 21 – 23) stützen. Zwar heißt es dort, nach einem geänderten Bauzeitenplan hätten die Betonarbeiten bis Oktober 2009 statt bis Weihnachten fertiggestellt sein sollen.
Der Senat verkennt auch nicht, dass die Sachverständige im Termin vom 18.11.2022 erklärt hat, aufgrund einer Verkürzung des Zeitraums für die Betonarbeiten auf den 04.11.2009 habe schneller gearbeitet werden müssen (Prot. S. 6, Bl. 1544 d. A.). Das entspricht nicht dem Vortrag der Klägerin. Sie hat in dem Nachtrag keine Kosten für die Fertigstellung der Betonarbeiten bis zum 04.11.2009 kalkuliert.
cc) Eine Verkürzung des ursprünglich vertraglich vorgesehenen Leistungszeitraums scheidet auch wegen des in dem in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis enthaltenen Bauzeitplan vorgesehenen Beginns der Zimmerer- und Dacharbeiten im November 2009 aus. Die Klägerin musste erkennen, dass die Wände und Decken bis dahin fertiggestellt sein mussten.
Die Klägerin hatte nach dem Leistungsverzeichnis (Pos. 1.2.1) ein Gerüst für die Folgegewerke nach Erstellung der Rohbauarbeiten zu erstellen. Das Gerüst war unter anderem für Arbeiten am Dach notwendig. Die Aufstellung des Gerüsts setzte voraus, dass der Rohbau bereits stehen musste, jedenfalls die Wände, an denen das Gerüst aufzustellen war.
Der Beginn der Arbeiten an dem Dachstuhl und dem Dach setzt voraus, dass zu diesem Zeitpunkt der Rohbau soweit steht, dass das Dach darauf errichtet werden kann. Auch das setzt die Fertigstellung der Wände und der Decken voraus.
b) Im Übrigen fehlte selbst im Falle einer relevanten Baubeschleunigung für einen Anspruch aus § 2 Abs. 5 VOB/B eine rechtsgeschäftliche Anordnung eines Vertreters der Beklagten. Die von der Klägerin herangezogenen Bauzeitpläne sind ihr von den Streithelfern übergeben worden. Diese waren nicht für rechtsgeschäftliche Erklärungen im Namen der Beklagten bevollmächtigt.
3. Das Urteil des Landgerichts ist in Höhe von 71.613,64 Euro rechtskräftig geworden. Insoweit hat die Beklagte das Urteil nicht angegriffen. In Höhe von insgesamt 354.997,98 Euro war die Klage abzuweisen. In Höhe der Differenz von 409,84 Euro zu dem vom Landgericht ausgeurteilten Betrag von 427.021,46 Euro war die Beklagte zur Zahlung zu verurteilen.
Der von der Beklagten angegebene Zahlbetrag von 123.724,23 Euro beruht auf einem offensichtlichen Rechenfehler. Dieser Betrag ergibt sich, wenn man den von der Beklagten angegriffenen Betrag von 355.407,82 Euro von der ursprünglichen Klagesumme von 479.132,05 Euro abzieht. Tatsächlich ist von der Höhe der Verurteilung auszugehen. Der Antrag der Beklagten ist dahin auszulegen, dass sie in erster Linie die Klagabweisung in Höhe von 355.407,82 Euro anstrebt, nicht die Verurteilung zur Zahlung von 123.724,23 Euro.
Im Übrigen käme eine Verurteilung in dieser Höhe nicht in Betracht, weil die Klägerin die teilweise Klageabweisung durch das Landgericht nicht angegriffen hat.
Die Klage ist in Höhe von 301.780,25 Euro brutto (253.596,85 Euro netto) abzuweisen, weil der Klägerin kein weiterer Werklohn nach dem Nachtrag 6 zusteht. Diesen Betrag hat das Landgericht seiner Verurteilung zugrunde gelegt. Das Landgericht hat sich für die Höhe des Betrages auf das Gutachten der Sachverständigen gestützt (Urt. S. 42, 44), die diesen Betrag ermittelt hatte (GA v. 07.03.2017, S. 97). Bei dem vom Landgericht auch genannten Betrag von 253.941,25 Euro netto (Urt. S. 43) handelt es sich um einen offensichtlichen Schreibfehler.
Die Beklagte ist bei der Berechnung des angegriffenen Betrages von dem letzteren Betrag ausgegangen.
Der Angriff ist daher um 409,84 Euro brutto (344,40 Euro netto) zu hoch. In dieser Höhe ist ihre Berufung unbegründet. Sie war entsprechend zur Zahlung weiteren Werklohns nebst Zinsen zu verurteilen. Wegen der Verurteilung zur Zinszahlung wird auf das angefochtene Urteil Bezug genommen, das von der Beklagten insoweit nicht angegriffen worden ist.
Die Klage ist in Höhe weiterer 53.217,73 Euro brutto (44.720,78 Euro netto) zurückzuweisen, weil der Klägerin kein weiterer Werklohn nach dem Nachtrag 7 zusteht. Das Landgericht hat diesen Betrag seiner Verurteilung zugrunde gelegt.
4. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 101 Abs. 2 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Zulassung der Revision ist nicht angezeigt, weil die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert (§ 543 Abs. 2 ZPO). Es handelt sich um eine Entscheidung im Einzelfall. Die entscheidungserheblichen Rechtsfragen sind geklärt.